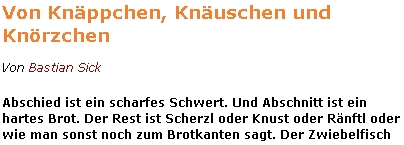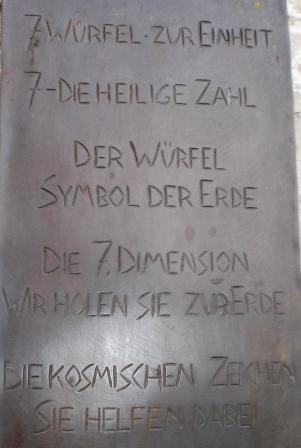Bereits am Satzanfang — Syntaktische Feinheiten der Schweizer Schriftsprache
Oktober 12th, 2009(reload vom 20.9.06)
Seit einiger Zeit beobachten wir in den Schweizern Medien, vor allem im Tages-Anzeiger und in der Nachrichtensendung „10 vor 10“, eine syntaktische Besonderheit, von der wir nicht ganz sicher sind, ob sie nun spezifisch schweizerisch ist oder nicht. Es geht um den Satzanfang mit „bereits“, ohne ein folgendes Zeitwort.
Beispiel:
Bereits ist es den USA geglückt, dank der Lancierung der Pipeline Baku (Kaspisches Meer) – Tbilissi (Georgien) – Ceyhan (Türkei) eine Bresche in das russische Monopol beim Öltransport zu schlagen.
(Quelle: Tages-Anzeiger)
Oder hier:
Bereits ist es einigen Programmierern gelungen, auf der PSP raubkopierte Spiele laufen zu lassen
(Quelle: Tages-Anzeiger)
Der Satz ist nicht falsch, aber irgend etwas fehlt uns hier. Vielleicht ein „Bereits heute“, oder ein „schon jetzt“? Wir haben noch weitere Verwendungen gefunden:
Bereits ist es möglich, mit Techniken wie der Positron-Emission-Tomographie (PET) die Hirnaktivität beim Auftreten veränderter Bewusstseinszustände nicht nur zu messen, sondern die einzelnen Zustände entsprechenden Hirnregionen zuzuweisen.
(Quelle: Tages-Anzeiger, zitiert auf hanflobby.de)
Auch hier kommt uns das Ganze einfach zu knapp vor. Es fehlt ein „bereits heute“. Beim nächsten Beispiel ist es nur die Reihenfolge, die uns merkwürdig vorkommt:
Bereits ist es einige Zeit her, dass uns Anna Witzig verlassen hat.
(Quelle: Tages-Anzeiger)
Bei diesem Beispielsatz kommt uns die Wortstellung ungewohnt vor. Wer ein wenig die Augen offen hält und darauf achtet, wird sicher rasch weitere Beispiele finden. Für uns kommt diese Besonderheit der helvetischen Syntax in die gleiche wundervolle Sammlung mit „für einmal“ und „erst noch“ (vgl. Blogwiese).
Oder ist das alles gar nichts Besonderes und es findet sich auch massig Verwendungsbeispiele für „Bereits“ am Satzanfang ohne Zeitwort in Deutschland, und ich kriege hier einfach nur die helvetische Paranoia? Bereits spüre ich so ein Ziehen im rechten Ohr. Für einmal gibt es keine Erklärung und erst noch muss ich darüber nachdenken. Bereits ist es spät. In dem Fall bis morgen dann.