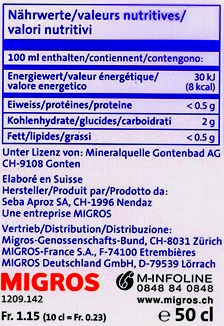Die EU als Bürokratie des Bösen
Im Tages-Anzeiger vom 16.05.07 schreibt der Publizist Roger de Weck über das „getrübte Bild“ der Schweizer von Europa:
In den gut 700 Jahren Schweizer Geschichte haben wir nie einen so guten Nachbarn gehabt wie die Europäische Union. Doch mancher Schweizer stellt dieselbe EU als Bürokratie des Bösen hin. Der Europäischen Union verdanken wir Ordnung und Stabilität auf unserem Kontinent. Trotzdem sprechen der Schriftsteller Thomas Hürlimann oder Bundesrat Christoph Blocher von der EU als einer Fehlkonstruktion. Welch eine Vermessenheit: Ist es wirklich eine Fehlkonstruktion, die Frieden brachte auf unserem blutigen Kontinent?
Ohne die EU wäre nach dem Untergang der Sowjetunion geschehen, was jedes Mal geschieht, wenn ein Imperium zerbricht: Krieg, Bürgerkrieg, Wirren ohne Ende. Frieden aber herrscht im Einzugsgebiet der Europäischen Union. Warum? Weil die beitrittswilligen Länder Wirtschaftsreformen anpackten, die jetzt für Stabilität und Wachstum sorgen.
Roger de Weck stellt die Entwicklung der EU den Zerfall Jugoslawiens gegenüber:
Wo die EU keinen Rahmen setzen konnte, kam es zum Blutbad auf dem Balkan. Überall sonst ist Osteuropas Umbruch dank der EU ein unglaublicher Erfolg. Verdanken wir diesen Segen einer Fehlkonstruktion?
Die grosse europäische Eidgenossenschaft
Er sieht eine weitere Parallele zwischen in Staaten in der EU und den Kantonen in der Schweiz, welche von den Schweizern leider verkannt wird:
Die EU ist nichts anderes als eine europäische Eidgenossenschaft. Wie die Schweiz ist sie eine unermüdliche Herstellerin von Kompromissen, von Interessenausgleich – ein Gemeinwesen der Balance. Dank der EU leben wir in einem Europa des Augenmasses. So wie sich hier zu Lande 26 Kantone zusammenraufen, so haben sich auf unserem Kontinent 27 Nationen zusammengerauft – das ist weltweit einzigartig. (…)
Alles in allem ist die EU liberaler als die Schweiz. Aber bei uns gilt sie als Ausbund an Dirigismus. Und dank ihrem Binnenmarkt trägt die Europäische Union ganz wesentlich zum Schweizer Wohlstand und zum Erfolg hiesiger Konzerne bei. Doch wir tun so, als wolle uns dieselbe EU bei jeder Gelegenheit übervorteilen. Welch überspanntes Vokabular ist zu hören im Steuerstreit. Da brandet ein Chauvinismus, ein Steuer- und Rabattpatriotismus, der Fragen aufwirft. Kann es sein, dass politischer Nationalismus dazu dient, die Globalisierung des Ökonomischen zu kompensieren? (…)

(Landsgemeinde in Glarus. Quelle Foto: Wikimedia)
Ist Europa wirklich undemokratisch?
Tatsächlich sind es die grossen Schweizer Banken und Unternehmen, die längst an der Globalisierung des Ökonomischen gewaltig teilhaben. Die Schweizer sind stolz auf ihre direkte Demokratie und werfen den Ländern Europas vor, sich wenig oder gar nicht um den Willen ihrer Völker zu scheren:
Was werfen Volk und Schweizer Medien der EU vor? Dass sie undemokratisch sei. Und in der Tat, nach dem Zweiten Weltkrieg verloren Gründerväter wie Jean Monnet keine Zeit, das europäische Haus des Friedens zu errichten. Erst später ging man daran, dieses Friedenshaus zum Haus der Demokratie auszubauen. Oder anders gesagt: In vielem bleibt die EU ein Staatenbund. Dabei weiss jeder, dass Staatenbünde undemokratisch sind, weil per definitionem Regierungen miteinander verhandeln und zwangsläufig ihre Parlamente, ihre Bürger vor vollendete Tatsachen stellen.
Die Alternative, damit sich Demokratie entfalten kann, wäre ein europäischer Bundesstaat. Aber just ein solcher «Superstaat » ist die Horrorvision derer, die der EU ihren Mangel an Demokratie vorhalten. Zugespitzt darf man sagen: Diese Kritiker würden das Ergebnis ihrer Kritik erst recht kritisieren. So erliegen sie einer eigenen «intellektuellen Fehlkonstruktion». Wer weder den Staatenbund noch den Bundesstaat gelten lässt, der hat im Grunde gar keine Position. (…)
Doch, nämlich die Haltung: „In Europa darf die politische Lage nicht positiv gesehen werden, denn das würde die Lage der Schweiz als Insel der glückseeligen Demokraten in ein schlechtes Licht rücken“.
Kann man woanders als in der Schweiz glücklich sein?
Roger de Weck schreibt weiter:
Eines der klarsichtigsten und schönsten Bücher über den europäischen Gedanken verdanken wir dem Eidgenossen Adolf Muschg, der Titel lautet schlicht: «Was ist europäisch?» Doch die «NZZ am Sonntag» ist sich nicht zu schade, Muschg vorzuwerfen, er verweile zu oft in Berlin, was ihn negativ beeinflusse. Wer auf solche Weise antiintellektuelle und antideutsche Ressentiments auslebt, dem möchte man mit Gottfried Keller und seinem Gedicht «Gegenüber» antworten. Gottfried Keller – auch er ein Wahldeutscher, auch er kein schlechter Eidgenosse und ein vorzüglicher Europäer: «Wohl mir, dass ich dich endlich fand, / Du stiller Ort am alten Rhein, / Wo ungestört und ungekannt / Ich Schweizer darf und Deutscher sein!» Die Schweizer Europafeindlichkeit ist durchaus auch zurückzuführen auf die Ressentiments der Deutschschweizer gegenüber dem «grossen Kanton». Wohingegen die Romands mit ihrer unbelasteten Beziehung zu Frankreich auch ein unbefangenes Verhältnis zum Europäischen haben. Der Nachbar prägt das Europabild, aus jeder Kultur erwächst eine andere Weltanschauung, die Europafrage wirft die Frage nach dem Schweizer Selbstverständnis auf.
Womit wir wieder bei unserem Lieblingsthema wären. Was ist das Schweizer Selbstverständnis? Alles ist möglich, alles ist erlaubt, so lange bloss der Unterschied zum die Deutschen Nachbarn deutlich bewahrt bleibt.
Was passiert wenn eine Krise kommt?
Roger de Weck überlegt sich, wie sich das gespaltene Verhältnis der Schweizer zur EU in einer Krise auswirken würde. Solche Situationen gab es, denken wir an die Katastrophe von Tschernobyl 1986 oder die Folgen des 11. Septembers. Wenn in einer Krise Europa zusammenrückt und seine Grenzen dicht macht, dann steht die Schweiz plötzlich ziemlich allein in der Welt:
Man stelle sich eine schwere Krise vor, die nie auszuschliessen ist: Engpässe, Verteilungskämpfe, eine Umweltkatastrophe, einen Finanzkrach. Hätte das Land ausserhalb der Europäischen Union die besseren Karten? Von heute auf morgen würden wir beitreten wollen, aus einer Position der Schwäche und zu schlechten Bedingungen.
Der Verzicht auf eine langfristig angelegte Europapolitik stärkt weder unser Land noch seinen Zusammenhalt. Auf die EU sind wir angewiesen, trotzdem stellen wir uns seit fünfzig Jahren ausserhalb dieser Rechtsgemeinschaft. Lieber pflegen wir diplomatische Beziehungen, hinter denen seit jeher in der Weltgeschichte das Recht des Stärkeren lauert.
Wir erinnern uns an die Wochen im März 2004, als die Kontrollen an der Deutsch-Schweizer-Grenze plötzlich verschärft wurden und in der Schweiz die Befürchtung geäussert wurde, es handele sich um eine Strafaktion:
Die verschärften Kontrollen an der deutschen Grenze sind laut Joschka Fischer kein Druckversuch gegen die Schweiz, führen aber die Probleme des Alleingangs vor Augen. Im Fall eines Schweizer Beitritts zum Schengen-Raum der EU wären die Personenkontrollen hinfällig.
(Quelle: baz.ch)
Im Oktober 2004 wurde in der Schweiz über den Beitritt zum Schengener Abkommen abgestimmt:
Die Schweiz ratifizierte das Abkommen am 16. Oktober 2004. Gegen das Abkommen wurde das Referendum (Volksentscheid) ergriffen, damit die Vorlage vom Volk angenommen werden muss. Bei der Volksabstimmung am 5. Juni 2005 stimmten 54,6 Prozent der Schweizer Bevölkerung für den Beitritt zum Abkommen. Es wird voraussichtlich ab 2008 nach Einrichtung der erforderlichen Sicherheitssysteme in Kraft treten.
(Quelle: wikpedia.org)
Werden wir also ein bisschen sarkastisch und warten einfach die nächste Krise ab. Vielleicht geht dann alles viel schneller als gedacht. Wir vergessen niemals, wie einige Wochen nach Tschernobyl, als die ersten strahlenden Regenwolken Europa erreichten und sich dabei nicht um Grenzen kümmerten, sogar CDU Landratsfrauen, die bis dahin stets in grosser Distanz zu linken Kernkraftgegner zu finden waren, plötzlich im Supermarkt nur noch H-Milch und Dosengemüse kauften und die verstrahlte Frischmilch bzw. den frischen Salat nicht mehr anrührten. Sinneswandel in der Krise.
Ebenfalls wird es in den nächsten Jahren sicher spannend zu beobachten, wie lange die Schweiz bei einem fortdauernden weltweiten Erfolgskurs und Höhenflug des Euros, an ihrer Währung festhalten wird.