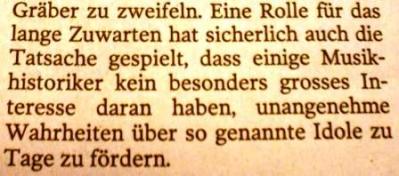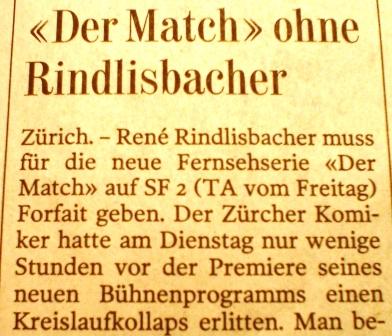Es gibt kein Bier in Deutschland, sondern viele Biere
In Deutschland gibt es praktisch in jeder Stadt eine andere Biersorte zu geniessen. Die Kölner trinken „Kölsch“, die Düsseldorfer „Alt“. Wenn Sie mal richtig Spass haben wollen in einer Kneipe der Kölner Altstadt, dann bestellen Sie lautstark, so das alle anwesenden Jecken es hören können, „eine Runde Alt für alle“.
Die Schwarzwälder trinken „Tannenzäpfchen“ oder unser Lieblingsbier, frisches „Alpirsbacher“ vom Fass. Die Bayern lieben Paulaner oder Weizenbier, bei dem es eine Kunst und Wissenschaft für sich ist, die Flasche schnell und mit Schwung so kopfüber ins hohe Weizenbierglas zu stellen, dass sie sich entleert ohne dabei allzuviel Schaum zu bilden.
Flens muss ploppen
Ganz oben an der Grenze zu Dänemark in Flensburg werden sie nicht umhin kommen, ein „Flens“ zu trinken, das aus der Bügelflasche, die so schön „plopp“ macht.

Diese Bierflasche wurde übrigens zum Verkaufsschlager auf Grund des „Werner“ Comix, weil dort permanent nur Bier aus Bügelflaschen gekippt wird. Nur handelte es sich hierbei nicht um die Sorte Flens (danke für die Hinweise in den Kommentaren!).
Berühmtes Zitat aus der Werner-Welt:
„Werner, Bölkstoff is‘ alle, sach mal Bescheid..“ Werner geht zur Theke und sagt: „Bescheid“. Werner kommt zurück und die Kumpels fragen ihn: „Na, hasse Bescheid gesagt?“. Antwort: „Na klar, man“
Pils dauert sechs Minuten
Ja, das vermissen wir manchmal in der Schweiz: Die Deutsche Biervielfalt. Obwohl man sie selten richtig geniessen kann, denn dort wo sie sich gerade befinden in Deutschland, von dort weden sie auch das Bier kredenzt bekommen. Die Deutschen nehmen sich Zeit zum Biertrinken. Und sie sind sehr skeptisch, wenn nach einer Bestellung in zu kurzer Zeit das Bier bereits serviert wird. Denn das lernen die Deutschen, sobald sie eine „Tulpe“ (so heisst das Bierglas wegen seiner Form) halten können: „Ein Pils dauert 6 Minuten“.

Schneller geht das nicht mit dem Zapfen, denn das Bier muss sich ja mit dem Schaum erst setzen können und die Deutschen schätzen eine schön geformte „Krone“ auf dem Glas. Anders als die Engländer, die ihr Glas immer bis zum Überlaufen gefüllt haben möchten und sich sonst vom Wirt betrogen fühlen. Wenn das Bier doch schneller serviert wird als in sechs Minuten, ist es entweder abgestanden oder der Wirt hat verschwenderisch die Hälfe daneben gehen lassen, statt die nötige Geduld aufzubringen.
Der magische Swimmingpool
Dazu gibt es einen alten Witz aus Helmut Kohls Regierungszeit:
Die Staatsoberhäupter Europas sind bei einem Scheich im Orient zu Gast. Der Scheich macht eine Führung durch seine Besitztümer und sie kommen schliesslich zu einem wunderschönen, vergoldeten Swimming-Pool ohne Wasser, aber mit Sprungturm. Der Scheich erklärt den erstaunten Gästen, das es sich hier um einen magischen Pool handelt. Man können vom Sprungturm aus hineinspringen, nachdem man einen Getränkewunsch geäussert habe, und schon füllt sich das Becken mit der gewünschten Flüssigkeit.
Mitterand macht den Anfang, klettert auf den Turm und sagt: „Champagner“ und springt. Das Becken ist sofort mit prickelndem Schampus gefüllt. Als nächstes klettert Craxi (Italien) auf den Turm und sagt: „Vino Rosso“, und sofort füllt alter italienischer Edelwein das Becken. Es folgen einige weitere Staatsoberhäupter, und schliesslich ist Kohl an der Reihe. Er klettert auf den Turm, sagt „Pils“ und springt. Prompt knallt er unten auf den harten Beckenboden, worauf eine Stimme aus dem Off ertönt: „Pils dauert 6 Minuten“…
Es gibt dann noch einen zweiten Teil, bei dem Kohl vor lauter Überlegen schliesslich das Gleichgewicht verliert, fällt, und im Fallen „Scheisse“ ruft, aber den lassen wir jetzt weg. Keine Witze über den Vater der Deutschen Einheit bitte.
Im Land der Biervielfalt
Denn Bierbrauen ist eines der ganz seltenen noch existierenden „Polypole“, was bedeutet: Viele kleine Anbieter teilen sich den Markt, die umsatzstärksten Brauerein haben zusammen nur einen geringen Marktanteil. Anders als in Skandinavien, wo Carlsberg 1970 den letzten Konkurrenten Tuborg schluckte und seitdem praktisch den Markt allein dominiert. Zu Carlsberg gehören heute die folgenden Marken in Deutschland und der Schweiz:
* Holsten Pils
* Astra, Hamburg
* Feldschlösschen in Braunschweig, Dresden und Rheinfelden AG (Marktführer in der Schweiz)
* Hannen Alt, Mönchengladbach
* Landskron, Görlitz
* Lübzer, Lübz
* Cardinal Lager, Freiburg im Üechtland (Schweiz)
(Quelle: Wiki)
Der Trend geht also auch in Deutschland dahin, dass immer mehr kleine Brauereien von grossen Anbietern wie z. B. Carlsberg geschluckt werden. Sie behalten pro forma ihren Namen, gehören aber zu grossen Bier-Konzernen.
Der Deutsche trinkt mehr Kaffee als Bier
Es ist übrigens auch ein Gerücht, dass die Deutschen viel Bier trinken. An erster Stelle kommt in Deutschland der Kaffee, der dünner und häufiger pro Tag getrunken wird, als Bier, rein vom Volumen her:
Was trinken die Deutschen am liebsten? Kaffee ist mit insgesamt 151 Litern pro Jahr Dauerspitzenreiter beim Verzehr. Mineralwässer – vor allem kohlensäurearme Sorten – wurden im letzten Jahr deutlich mehr konsumiert (135 Liter) und verbannen das Bier (118 Liter) auf Platz drei der Rangliste.
(Quelle: fitforum.msn.de)
Zusätzlich zu den grossen Brauereien, wie z. B. die Ganter-Brauerei in Freiburg im Breisgau, gibt es zahlreiche kleine Lokalbrauereien, die das Bier in geringer Menge nur für die eigenen Gäste brauen. Wir beobachten in Deutschland, dass die hohe Anzahl solcher lokaler Brauereien oft den Rückschluss zulässt, dass die eigentliche Marke im Ort nicht so beliebt ist. Eigentlich sollte ja nix drin sein im Bier, ausser Hopfen, Malz und Wasser, gemäss dem Reinheitsgebot:
Das bayerische Reinheitsgebot wurde am 23. April 1516 von dem bayerischen Herzog Wilhelm IV. (Bayern) in Ingolstadt erlassen. Dieser Erlass regulierte einerseits die Preise, andererseits die Inhaltsstoffe des Bieres. Es galt bis 1998 als das älteste Lebensmittelgesetz.
(…)
Das bayerische Reinheitsgebot war nicht das erste Gesetz seiner Art: Von folgenden Städten ist ein Erlass überliefert, der die Qualität des Bieres betraf: Augsburg (1156), Nürnberg (1293), Erfurt (1351), München (1363), Landshut (1409), Weißensee in Thüringen (1434), Regensburg (1447), Eichstätt (1507). Einige dieser Verordnungen wurden erst in den letzten Jahrzehnten wieder entdeckt. Es ist wahrscheinlich, dass in vielen Fällen keine Zeugnisse mehr erhalten sind und diese Liste deshalb nur exemplarischen Charakter hat.
(Quelle: Wiki)
Dennoch gab es in den letzten 500 Jahren auch beim Bier den ein oder anderen Skandal wegen unerlaubter Zusatzstoffe im Gerstensaft, was aber die Freude der Deutschen an diesem Getränk nicht wesentlich trüben konnte. Bekanntlich trinken die Deutschen ihre Bier nicht stangenweise, wie die Schweizer, sondern lieber in Massen, aus einer „Mass“ genauer gesagt.

Ach, jetzt vermissen wir plötzlich das Deutsche Scharf-ß, denn ohne dies sieht es ja so aus, als ob die Deutschen nur in grossen Menschenmassen Bier trinken würden! Solches passiert vorwiegend in München, auf dem Oktoberfest. Aber das ist ja definitiv nicht in Deutschland, sondern im „Freistaat Bayern„.
Bayern ist übrigens ein dreisprachiges Land:
Gesprochen werden mehrere Dialekte aus drei großen Dialektfamilien:
Bairisch im Großteil des Landes (Nord- und Mittelbairisch, am Rand zu Tirol auch Südbairisch)
Fränkisch von etwa 3 Millionen im nördlichen und westlichen Landesteil
Alemannisch von 2 Millionen Schwaben im Westen
(Quelle Wiki)
Aber jetzt kommen wir wirklich zu weit vom Thema ab, Bayern ist nicht unser Bier. Und ein solches werden wir jetzt trinken. Prost!