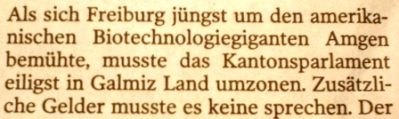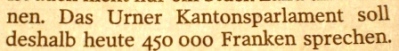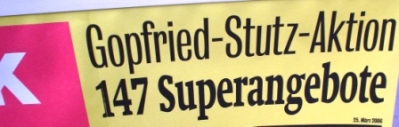Firewall muss nicht übersetzt werden
Eigentlich wollten wir heute ins Kino gehen, in den neuen Action-Thriller mit Harrison Ford. „Firewall“ heisst der Streifen. Ein äusserst praktischer Titel, weil er nicht übersetzt werden muss für die Kinos in Deutschland. Nur der letzte freiwillige Feuerwehrmann vom Lande würde hier einen Film über „Feuerwände“ vermuten, denn in Zeiten von Internet und Email sind Würmer schon lange keine Tiere mehr, die wir fürs Angeln brauchen, und ein „Trojaner“ wird auch erst seit dem Sandalenfilm mit Brad Pitt wieder in Verbindung mit einer antiken Stadt und einem grossen Holzpferd gebracht. Bis dahin war es irgendetwas Böses, was unseren Computer lahmzulegen versteht, wenn es unsere Antiviren-Software nicht rechtzeitig findet und vernichtet.
Was ist eine Brandschutzmauer?
„Brandschutzmauer“ nennt man eine Firewall auf Deutsch, in Grossstädten soll sie helfen, beim Brand eines Hauses das Übergreifen der Flammen auf das danebenliegende Haus zu verhindern. Brandschutzmauern sind daher dick und haben keine Fenster oder Türen. Firewalls in der IT-Welt hingegen haben jede Menge Löcher, mit voller Absicht hineingeschlagen, um kontrollierte Datenströme durchzulassen.
Und was ist ein Fireman?
Wenn wir es gerade vom Feuer haben: Wussten Sie, dass der deutsche „Feuerwehrmann“ auf Englisch nur „Fireman“, ohne „Wehr“ im Wort heisst? Das lässt natürlich Wortspiele und Assoziationen zu, die auf Deutsch kaum möglich sind, und vom amerikanischen Autoren Ray Bradbury in seinem SF-Klassiker „Fahrenheit 451“ (der Temperatur, bei der Papier anfängt zu brennen) weidlich ausgenutzt werden.
Doch eigentlich wollten wir ja ins Kino gehen.
Dann sahen wir den Trailer für „Firewall“, natürlich nicht den gleichnamigen tiefen PKW– oder Bootsanhänger, sondern den
(…) aus einigen Filmszenen zusammengesetzter Clip zum Bewerben eines Kino- oder Fernsehfilms, eines Computerspiels oder einer anderen Veröffentlichung. Der Zweck eines Trailers ist es, dem Publikum einen Vorgeschmack auf das beworbene Produkt zu geben und natürlich Werbung für dieses zu machen.
(Quelle: Wiki)
Und plötzlich wollten wir den Film gar nicht mehr sehen. Der Grund war ein Ausschnitt, in dem Harrison Ford als „Hacker“ zu sehen ist, wie er sich in einen Bankcomputer einhackt und Manipulationen vornimmt. Denn da waren sie wieder: Die grünen Buchstaben, die Rattergeräusche und die blinkenden Warnmitteilungen.
Kein Microsoft in Hollywood
Wir schreiben das Jahr 2006, seit mehr als 10 Jahren gibt es die grafische Benutzeroberfläche Windows, mit Taskleiste, Start-Button und hübschen Programmen wie Excel und Word auf der Oberfläche. Nicht so in Hollywood. Wir haben in den letzten 10 Jahren viele Kinofilme gesehen, die das Thema Computer am Rand oder als Hauptsujet behandelten. Bisher ist uns in (fast) keinem Film Hollywoods jemals eine Windows-Oberfläche gezeigt worden. Woran das wohl liegt? Gibt es die Produkte von Microsoft in Hollywood gar nicht? Arbeiten dort wirklich alle nur mit Apple-Computer, wie es der Film „Independence Day“ zeigt, in dem sogar die ausserirdische Bedrohung über einen von einem Apple-Computer gespeisten Virus schachmatt gesetzt wird?
Zahlt Bill Gates der „Product-Placement-Mafia“ einfach nicht genug oder ist er dazu vielleicht überhaupt nicht bereit? Was wenige wissen: Auch für die Apple-Gemeinde liefert Microsoft fleissig Produkte (jetzt sogar Windows!), z. B. die Office Suite, die sind aber niemals in einem Film zu sehen. Wurde je ein Outlook in einem Hollywood-Film gezeigt? Es gibt zwar „You’ve got mail“, und „Email für Dich“, doch mit welchen Mailprogrammen wurde hier gedreht? Phantasieprodukte…
Wie funktioniert der „Computer-Topos“ im Film?
Eine gängige Übersetzung für „Topos“ (Plural Topoi) ist „Ort“, oder „Allgemeinplatz“. Man versteht laut Wiki darunter
einen abstrakten Ort, aber auch eine Formkategorie.
• In den Geistes- und Kulturwissenschaften wird der Begriff Topos sowohl für Kategorien als auch für Bilder verwendet. Beispielsweise stellt die Kategorie „Definition“ einen Topos dar. Man spricht vom „Topos der Gottesstrafe“ oder vom „Topos der Musikstadt Wien“. (…)
• In der Literaturwissenschaft ist ein „Topos“ ein bezeichnender Einzelzug, z. B. der Topos der „bösen Stiefmutter“ oder auch der „liebliche Ort“ (lat. locus amoenus) in der Natur, an dem die Handlung vorübergehend inne hält.
Und was hat das jetzt mit Computer in Filmen zu tun? Nun, es ist einfach ein „Topos“, dass Computer in Hollywoodfilmen immer
a) grüne Schrift verwenden, die
b) von links nach rechts zeichenweise lesbar schreiben, ähnlich wie Fernschreiber (für die Jüngeren unter uns: Das waren die Vorläufer der Faxgeräten).
c) dabei möglichst rattern wie eine mechanische Schreibmaschine oder eine blechernde Maschinenstimme hören lassen,
d) nie nie nie eine Windows oder Office Application auf dem Screen zeigen,
e) nie nie nie eine Grafik sofort auf den Bildschirm bringen, es sei denn es handelt sich hier um ein „Warning“ Schild, oder „Access Denied“, das aber dann blinkend und im überdimensionalen Textmodus.
Die einzige Annäherung hinsichtlich „Grafikmodus“, die Hollywood je bereit war, am Bildschirm zu zeigen, war ein „Fortschrittsbalken“ bei Kopieraktionen, wenn der Held oder die Heldin gerade versucht, enorm wichtige Daten auf eine Diskette zu kopieren, und das mindestens 20 Sekunden dauert, in denen die Feinde immer näher kommen, und der Balken furchtbar langsam über den Bildschirm wandert.
Jeder weiss doch, wie eine GUI aussieht
Das merkwürdige an diesen Computer-Topoi ist nur, dass sie im krassen Gegensatz zur Lebenserfahrung der Zuschauer stehen. Heutzutage weiss doch jeder, wie eine grafische Benutzerschnittstelle, ein „Graphical User Interface“ aussieht. Selbst die Linux-Anhänger haben ihre GUIs mit Icons und Taskleiste.
Krach im Weltall? Kein Problem…
Anders ist es beim Topos „Krach im Weltraum“: Wir wissen zwar, dass im leeren Raum kein Geräusch übertragen werden kann, es dort also absolut lautlos zugehen müsste. Dennoch lieben wir den Explosionskrach und die Triebwerkgeräusche in jedem Sciencefiction. Nur der Film „Lautlos im Weltall“ = Silent running durchbricht diesen ehernen Film-Topos, nämlich dass Filme wie „Starwars“ schön laut im THX Sound auf das Kinopublikum einwirken müssen. Für das Weltall fehlt uns die persönliche Erfahrung, da ist uns ganz egal, wenn wir ein bisschen betrogen werden. Der Hörspass ist wichtiger. Aber bei den Computern wird das Publikum wohl nie anfangen, sich gegen diesen Unsinn zu wehren.
Doch, ich fange heute damit an und gehe nicht in diesen Film, solange dort grüne Schrift und ratternde Buchstaben zu sehen sind. Ist mir einfach zu blöd…
P. S.:
Wir haben uns den Film dann 2 Tage später doch noch angesehen. Die grüne Schrift baute sich zeilenweise auf dem Bildschirm auf, wie erwartet. Harrison Ford bastelte aus einem IPod und einem Fax-Lesekopf einen OCR-Scanner, der mit der Batterie des IPods lief. Schick, wirklich schick. Jede Menge DELLs waren im Bild, wahrscheinlich der offizielle Sponsor. Und wir konnten das „Windows XP Professional“ Logo auf einem Notebook erkennen! Damit ist es das zweite Mal, das wir Windows in einem Hollywood-Film entdecken konnten. Beim ersten Mal war es ein arabisches Windows 3.0 im Film „True Lies“ mit Arnold Schwarzenegger.