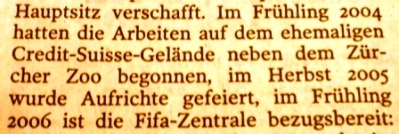Wer stiehlt schon sein eigenes Velo? — Was tun wenn das Schloss nicht mehr aufgeht?
November 18th, 2008Neulich wollte ich auf dem Heimweg am Abend mein Fahrrad Velo am Bahnhof in Bülach aufschliessen und musste feststellen, dass dies nicht möglich war. Jemand hatte, einfach so, das Schloss mit Sekundenkleber zugeklebt. Es gab keine Möglichkeit, es normal zu öffnen, selbst unter Zuhilfenahme von zwei Zangen bewegte sich nichts. Da muss es doch tatsächlich jemanden in Bülach geben, der mit einer Tube Sekundenkleber durchs Städtchen marschieren und so den Verkauf neuer Veloschlössern ankurbelt. So wie im Filmklassiker „The Kid“ mit Charly Chaplin als Glaser, für den ein kleines Kind die Glasscheiben potentieller Kunden einwarf.
Das Schloss war nicht zu öffnen. So ging ich zum nahen Velobetrieb meines Vertrauens und fragte nach der ganz grossen Zange, die mit den überlangen Griffen. Sowas habe man nicht, da reiche eine kleine Spezialbeisszange völlig aus. Nicht ganz überzeugt lief ich mit der geliehenen Minizange zurück zum verschlossenen Velo. Was glauben Sie, wie lange es dauerte, das 10 mm dicke Stahlkabel des Schlosses zu durchtrennen? 15-30 Minuten? Das dachte ich auch, aber nach genau 3 Mal zubeissen mit der Spezialzange in nur 30 Sekunden war das Stahlkabel durchtrennt.
Jetzt verstehe ich besser, warum so viele Velobesitzer in Bülach ihre Alltagsräder nur mit sehr billigen Schlössern ausstatten. Oftmals braucht man nur einen kräftigen Hammerschlag, um so ein Schloss zu öffnen. Es nutzt überhaupt nichts, ein dickeres Kabel zu wählen. Dann schon lieber ein festes U-Schloss. Bei einem solchen ist mir bereits zweimal der Schliessmechanismus kaputt gegangen. Das Schloss war mit dem Schlüssel nicht zu öffnen. Zum Glück war es nicht angeschlossen, und ich konnte es zu einer Baustelle tragen. Dort bat ich einen Bauarbeiter mit einer Flex um Hilfe. Diese Maschine durchtrennte den Stahlbügel in 20 Sekunden. Als würde man mit einem Messer durch weiche Butter fahren. Gibt es eigentlich schon eine Akku-Flex? Wäre das ideale Werkzeug für Fahrraddiebe.
Vor einigen Jahren musste ich auch mal mein eigenes Velo, dessen Ringschloss ebenfalls nicht mehr zu öffnen war, morgens um 10:00 Uhr in einer belebten Fussgängerzone mit einer grossen Zange aufbrechen. Ein Passant fragte mich noch: „Sind das hier Dreharbeiten für die Sendung `Versteckte Kamera´?“. Ein Mann aus einem nahen Kaufhaus kam dazugerannt. Ich dachte, das sei der Ladendetektiv, der mich nun gleich verhaftet für mein schändliches Tun. Stattdessen fragte mich der Mann freundlich: „Kann ich Ihnen helfen?“, tat es, hielt das Schloss für mich in einem günstigen Winkel, und als wir nun zu zweit mit Aufbrechen beschäftigt waren, da drehte sich niemand mehr nach uns um. Das musste seine Richtigkeit haben, wenn zwei Männer am hellichten Tag in aller Öffentlichkeit ein Schloss knacken.
In Bülach sieht man fast in jeder Woche irgendwo ein herrenloses Velo herumstehen oder liegen. Gestohlen für eine schnelle Fahrt, wenn in der Nacht der Bus zu teuer war oder zu lange auf sich warten liess, und dann irgendwo am Strassenrand entsorgt. Sie werden von der Polizei eingesammelt und einmal im Jahr auf einer „Gant“ versteigert. Aber nur mit Gantrotteldoppel (siehe Blogwiese)
Wer sein Velo behalten will, der gibt es in die Obhut einer bewachten Velostation oder besorgt sich zwei bis drei dicke U-Schlösser. Und für den Notfall immer eine Akkuflex in der Satteltasche mitnehmen.