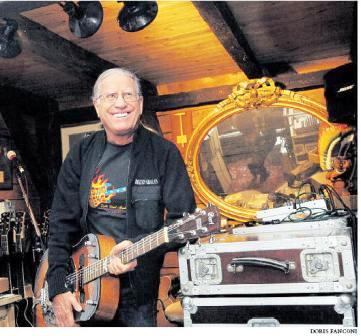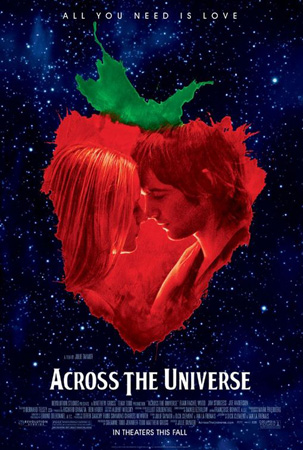Die Grenze des Erträglichen — Wieviel Deutsche erträgt die Uni Zürich?
Januar 8th, 2008Unter diesem Aufmacher brachte die Süddeutsche am 28.12.07 einen Artikel über die Deutschen in der Schweiz:
Schweizer beklagen die Welle deutscher Einwanderer. Nach Ärzten und Managern stehen jetzt die deutschen Wissenschaftler in der öffentlichen Kritik: Vielen Schweizern sind sie zu dominant.
(Quelle für dieses und alle folgenen Zitate: Sueddeutsche.de)
Der Autor Gerd Zitzelsberger reagiert damit auf die Berichterstattung des Tages-Anzeigers kurz vor Weihnachten:
25 Schweizer, 24 Deutsche
Auslöser der jüngsten Diskussion sind Entscheidungen der Universität Zürich. Kurz vor Weihnachten hat sie acht neue Professoren berufen. In allen acht Fällen kamen deutsche Bewerber zum Zuge. Im Jahr 2007 hat die Universität 57 Professoren-Stellen neu besetzt. Bei 25 Auswahlverfahren kamen Schweizer zum Zuge, in 24 Fällen Deutsche, und acht Stellen wurden mit Ausländern aus anderen Staaten besetzt. Jeder dritte Hochschullehrer an der Uni Zürich stammt mittlerweile aus „dem großen Kanton im Norden“, wie die Schweizer Deutschland ironisch titulieren.
Die Ironie muss erklärt werden. Dass Schweizer einfach so Ironie verwenden, wenn sie über Deutschland sprechen, erwartet dort tatsächlich niemand.
Ausgangspunkt der Diskussion war ein Interview mit Stefan Fischer, dem Präsidenten des Studentenrates der Uni Zürich:
„Wir erreichen – zumindest in einzelnen Fächern und Instituten – die Grenze des Erträglichen„. An manchen Instituten werde praktisch nur noch hochdeutsch gesprochen. Die Studenten fühlten sich arrogant behandelt und es sei frustrierend, wenn die Professoren kein Schwyzerdütsch verstünden oder verstehen wollten.
Im ursprünglichen Interview konnte Stefan Fischer noch so oft betonen, dass der Studentenrat grundsätzlich migrationsfreundlich und weltoffen eingestellt sei, und dass die meisten Deutschen sich wunderbar anpassen in Zürich. Das Zitat von der „Grenze des Erträglichen“ wurde dennoch mehrfach wiederholt.
Wurde im Januar noch vom BLICK gefragt „Wieviele Deutsche verträgt die Schweiz“, sind sie nun nicht mehr „erträglich“, obwohl sie fleissig am Ertrag und Bruttosozialprodukt des Landes Anteil haben. Gerd Zitzelsberger bringt noch ein weiteres Beispiel aus Bern:
Umgekehrt klagen auch die Deutschen in der Schweiz mittlerweile über ein ruppiges Klima und Schwierigkeiten, private Kontakte zu finden. Die Ärztin Bettina Wild etwa beschwerte sich per Leserbrief, dass die Uniklinik Bern ihre Stellenverlängerung abgelehnt habe, weil sie eine „dütsche Frau“ sei. Sie habe bereits auf verschiedenen Kontinenten gearbeitet und sich überall willkommen gefühlt, nur in der Schweiz nicht.
Kann man nur hoffen, dass die Uniklinik Bern aus dem reichhaltigen Angebot von Schweizer Bewerbungen eine passende neue Ärztin gefunden hat, die keine „dütsche Frau“ sei. Soll zur Zeit immer noch ziemlich schwierig sein.
Interessant an der ganze Debatte der „Erträglichkeit“ von Deutschen finden wir, dass sie gleich postwendend in Deutschland sprich in einer grossen Deutschen Tageszeitung reflektiert wurde. Aufhalten wird es den Zustrom aus dem Nachbarland kaum. Der Akademikernachwuchs geht dorthin, wo er die besten Konditionen findet. Das ist für Deutsche auf dem Weg in die Schweiz nicht anders wie für Schweizer, die sich an einer Hochschule in Deutschland bewerben. Vielleicht sollten sie zuvor ein Seminar für Verkaufstraining besuchen, um besonders erfolgreiches „self-marketing“ zu betreiben, denn auch dieses Argument wurde erneut zitiert. So stand in einem Leserbrief:
Die Deutschen könnten sich einfach nur „besser verkaufen“. Schweizer Nachwuchswissenschaftlern werde „aus fadenscheinigen Gründen die Professur verweigert“, behauptete einer.
Klar, die eidgenössischen Hochschullehrer, die in der Auswahlkommission sitzen, sind eben leicht zu blenden und mit ein bisschen hochdeutscher Rhetorik sofort über den Tisch gezogen:
Offizielle Stellen betonen zwar, dass es geradezu ein Qualitätsmerkmal sei, wenn eine Universität ausländische Akademiker anziehe, und dass man keinesfalls Ausländerquoten einführen wolle. „Für uns steht die Qualität der Lehre und Forschung im Vordergrund, nicht die Nationalität der Professoren“, betonte etwa Kurt Reimann, der Generalsekretär der Universität Zürich.
Vielleicht ist „Qualität“ gar nicht mehr so gewünscht, wenn sie nicht „Swiss Quality“ ist, und vielleicht ist heute „Swissness“ viel angesagter? Wo hatte ich noch gleich den Bauplan für die Zugbrücken hingelegt?