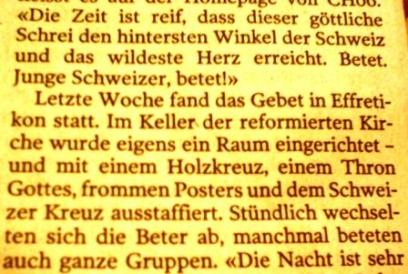Licht an, Licht aus — Autofahren mit Licht in der Schweiz
September 14th, 2009(reload vom 27.8.06)
Wer in die Schweiz zieht oder als Tourist in der Schweiz unterwegs ist bemerkt es schnell auf den Strassen: Hier fährt man gern mit Licht, auch am Tage. Was wir in Deutschland nur als Vorschrift für Motorradfahrer (Schweizerdeutsch „Töfffahrer“, mit drei „f“) kannten, um deren Verkehrssicherheit und Erkennungsrate zu steigern, ist in der Schweiz Usus auch für jeden motorisierten Verkehrsteilnehmer. Zum einen ist es ein ein Stück weit Faulheit, denn in manchen Gegenden oder auf bestimmten Strecken kommt man vor lauter Unterführungen, Tunneln, Galerien etc. gar nicht immer dazu, das Licht ständig wieder auszuschalten, so oft wie es angeschaltet werden muss. Natürlich sind all diese Tunnel und Strecken mit „Deckel“ oben drauf auch am Tag gut ausgeleuchtet, aber es erhöht die Verkehrssicherheit, hier das Licht angeschaltet zu lassen.
So wunderte es uns nicht, dass „Fahren mit Licht am Tag“, kurz „FLT“ in der Schweiz gesetzlich verankert wurde:
Ab Januar 2002 wird die Verkehrsregeln-Verordnung (Art. 31 Abs. 5) um eine neue Soll-Vorschrift ergänzt, wonach alle Motorfahrzeuge auch am Tag das Licht einschalten sollen: “Fahren mit Licht am Tag” (FLT). Ziel ist, zunächst auf freiwilliger Basis, später verpflichtend, dass nur beleuchtete Fahrzeuge unterwegs sind. Begründet wird die Massnahme mit der Erhöhung der Verkehrssicherheit.
(Quelle: fussverkehr.ch)
Diese Regelung hat von Seiten der organisierten Fussgänger der Schweiz keine Gegenliebe gefunden, sie sehen die schwächsten Verkehrsteilnehmer hier im grossen Nachteil:
Mehr Schaden als Nutzen für die Fussgängerinnen und Fussgänger
Fussverkehr Schweiz hat die begründete Vermutung, dass FLT den zu Fuss Gehenden mehr schadet als nützt: Fahrzeug Lenkende beachten andere Fahrzeuge mit Lichtern stärker als die zu Fuss Gehenden. Unbeleuchtete verschwinden im “Lichtermeer”. Die Summe aller Wahrnehmungen im Verkehr wird durch FLT nicht erhöht, das heisst die Wahrnehmung der Fussgänger durch die Autofahrer wird insgesamt schlechter.
(Quelle: fussverkehr.ch)
Da hilft nur eins: Beleuchtung auch für Fussgänger vorschreiben!
Dies ist ein alter Blues-Song der amerikanischen Blueslegende Little Walter, der von von etlichen Musikern nachgespielt.
Wir mussten an diesen Song denken, als wir in diesem Sommer mit dem Auto in England unterwegs waren. Hier herrscht die Devise, dass das Fernlicht nur in tiefster Nacht angeschaltet werden braucht. Der britische Autofahrer fährt ohne Licht, auch durch sämtliche Tunnel. Solche Tunnel führen in England nicht durch die spärlich vorhandenen Berge, sondern sie unterqueren die zahlreichen Buchten, Flüsse und „mouthes“ von Flüssen. Tunnel unter der Themse, Tunnel unter dem Mersey bei Liverpool, Tunnel unter den Tyne bei Newcastle, Tunnel und dem Hull bei Kingston. Meistens kosten diese Tunnel 3-6 Franken Mautgebühr und sind nur sparsam beleuchtet, was die britischen Autofahrer aber jetzt nicht dazu veranlasst, ihrerseits ihr Licht anzuschalten.
Hier die Tunnelausfahrt des Mersey-Tunnels bei Liverpool.

Von sechs Fahrzeugen haben drei kein Licht an, ein Mini fährt mit Standlicht, und nur die Volvos fahren mit Licht, denn bei denen schaltet es sich automatisch ohne Zutun des Fahrers ein.
Schilder, wie wir sie aus Deutschland oder der Schweiz kennen, die einen dazu auffordern, das Licht an oder auszuschalten, sucht man vergebens.
Wenn es ganz arg wird mit Nebel, Sprühregen oder der Abenddämmerung, schaltet der ein oder andere dann beherzt sein Standlicht ein. Muss reichen, solange man die Stossstange des voraus fahrenden Autos noch erkennen kann. Zum Ausgleich wird das so gesparte Benzin dann verpulvert, wenn auch bei Stillstand des Fahrzeugs während einer Pause der Motor laufen gelassen wird. Dabei kostet der Liter Benzin in Grossbritannien fast ein Pfund, d. h. zur Zeit 1.90 CHF
In Deutschland haben wir das „FLT“ noch nicht erlebt, aber es wird sicherlich auch dort kommen. Dann heisst es auch dort: „Licht aus, womm, Spot an, jaaa!“. Die älteren Leser werden diesen Satz aus der Deutschen Fernsehgeschichte kennen, er wurde von Ilja Richter in der Kultsendung „Disco“ (lief von 1971-82) geprägt:
Alle vier Wochen lockte die Sendung die deutsche Jugend vor die Bildschirme. Seine Sprüche („Licht aus, womm, Spot an, ja …“) sind zu geflügelten Worten geworden. Disco erreichte Traumeinschaltquoten. Wegen des großen Erfolgs kam die Sendung bald ins Abendprogramm. Das Außergewöhnliche an der Sendung war, dass Interpreten völlig unterschiedlicher Musikrichtungen (Schlager, Pop, Rock) nacheinander auftraten. Aufgelockert wurde das Programm von Einspielungen vorher aufgezeichneter Sketche, in denen Ilja Richter zusammen mit einem prominenten Gast auftrat. Während seiner Disco-Zeit hatte Ilja eine mehrjährige, vor der Öffentlichkeit verborgene Liebesbeziehung zu der Sängerin Marianne Rosenberg.
(Quelle Wikipedia)
Ilja Richter damals:

und heute:

(Quelle Foto: daserste.de)