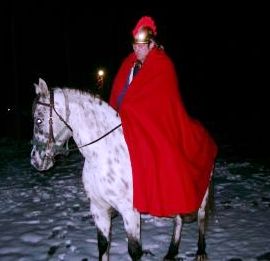Gut gestimmt zur „Abstimmig“
Oktober 6th, 2005Die Schweiz ist berühmt für ihre basisdemokratischen Volksabstimmungen. Damit bei der grossen Anzahl von Volksinitiativen nicht an jedem zweiten Sonntag abgestimmt werden muss, und so bald niemand mehr Lust haben könnte, zur Abstimmung zu gehen, werden die Referenden gesammelt und es wird an vier Terminen im Jahr darüber entschieden. Allein diese Terminfestlegung kann für das Los einer Initiative entscheidend sein, denn zu Abstimmungen, die zusammen mit einer herkömmlichen Wahl stattfinden, gehen erfahrungsgemäss mehr Wahlberechtigte.
In Deutschland gibt es keine „Volksbegehren“ auf Bundesebene. Nach der Verblendung in der Nazi-Zeit bis hin zur „Wollt ihr den totalen Krieg?“ Rede Goebbels, bei der alle befragten JA schrieen, hatten die Väter und Mütter des Deutschen Grundgesetzes genug von „Volkes Stimme“. Nur noch gefiltert über eine repräsentative Demokratie sollte über alle wichtigen Fragen entschieden werden.
In Baden-Württemberg (also auf Landesebene) kann das Volk zum Beispiel per Volksbegehren die Auflösung des Landtags bewirken.
Die Unterlagen werden den Schweizern einige Zeit vorher mit der Post zugeschickt, weswegen die meisten per Briefwahl abstimmen. In Deutschland ist es notwendig, die Briefwahlunterlagen für eine Bundestagswahl anzufordern, sonst ist nix mit Kreuzchen machen vom Urlaubsort aus. In der Schweiz überfliegen viele sofort nach Erhalt der Unterlagen die Themen, schreiben Ja oder Nein, tüten den Kram ein und ab geht die Post. Nur bei wirklich spannenden Themen steigt die Wahlbeteiligung auf über 50%.
Bei den letzten Gemeinderatswahlen in unserer neuen Wahlheimat wunderten wir uns besonders über die Art, mit der die verschiedenen Schweizer Parteien in den knallharten Wahlkampf einstiegen: Wir bekamen einen grossen Briefumschlag zugeschickt, mit einem gemeinsamen Anschreiben der Parteien, worin uns empfohlen wurde, die beiliegenden Informationen aufmerksam zu lesen und uns dann zu entscheiden. Abgesehen davon, dass wir als Ausländer sowieso kein Wahlrecht hatten, rätselten wir über diese Art von Konkurrenz. Da wird gegeneinander um die Stimmen der Wähler gestritten, gleichzeitig aber befürchtet, der Wähler könne böse werden, wenn man unsinnig viel Geld verpulvert und die 8 Broschüren einzeln per Post zuschickt. Die Parteien harmonieren also miteinander, und das bereits im Wahlkampf.
Besonders gefiel uns die Schweizer F.D.P., das ist die „Freisinnig-Demokratische-Partei“, „frei“ in dem Sinne, dass sie frei von Sinnen ist? Rätsel über Rätsel.
Als begeisterte Zeitungsleser haben wir in Deutschland gelernt, dass im Journalismus streng zwischen Textsorten „sachlicher Bericht“ (ohne Wertung), „Kommentar (mit Wertung), „Kolumne“ (mit persönlicher Meinung) etc. unterschieden wird. Nicht so in der Schweiz, hier steht bei jeder Abstimmung im Tages-Anzeiger zu lesen: „Die Haltung des Tagsanzeigers ist JA (oder NEIN)„.
Merkwürdig, wie wollen die noch neutral über die Pro- und Contra-Argumente berichten, zwecks eigener Meinungsbildung des Lesers, wenn sie selbst so deutlich Stellung beziehen? Seit kurzem gibt es den Plan für eine Volksinitiative, die verbieten will, dass der Bundesrat und die Bundesverwaltung öffentlich kund tut, ob sie für oder gegen eine Vorlage sind. Die Diskussion darüber nahm absurde Züge an, als die Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz sagte:
Das Volk hat immer das entscheidende letzte Wort. Aber das Volk hat nicht immer recht (Quelle)
Zu dieser Erkenntnis waren die Väter und Mütter des Deutschen Grundgesetzes auch schon gekommen.

Was ich bei den Abstimmungen in der Schweiz aber am liebsten mag sind die hipp-hopp retro-mässig cool designten Werbeplakate, die immer wieder aktuell kurz vor einer Abstimmung ausgehängt werden.