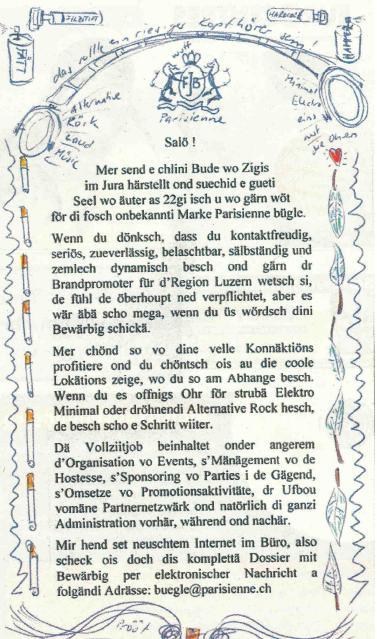Was verleidet der Verleider? — Haben Sie auch schon den Verleider bekommen?
April 30th, 2007In der Schweizer Gegenwartssprache entdecken wir immer wieder „Aktanten“, die uns bis dahin unbekannte Tätigkeiten hauptberuflich und in Vollzeit ausführen. Da wäre an erster Stelle der „Aufsteller“ zu nennen, dessen Tätigkeit für gute Laune sorgt und Stimmung bringt, aber ganz bestimmt nicht im sexuellen Bereich, denn dafür gibt es schliesslich Viagra von Pfizer oder Frank Baumann von Genial Daneben. Ach nein, der hatte ja einen anderen Job und war dort „der Tätschmeister“.
Dann als zweites der direkte Gegenspieler vom „Aufsteller“, sein Kontrahent, hierzulande bezeichnet als der „Ablöscher“. Leider arbeitet der selten bei der Feuerwehr sondern ist zuständig für das „kalte Ablöschen“, ähnlich wie in der alten Werbung für Fisherman’s Friend „Wie schmecken denn die„?
So stellen wir uns einen Ablöscher im echten Leben auch vor.
Dieser unfreundliche Zeitgenosse hat offenbar noch einen Kollegen, den „Verleider“
So lasen wir im Tages-Anzeiger:
Die Gäste, vor allem Familien, die für viel Geld ein Abo gelöst haben, bekommen schnell den Verleider, wenn sie es nicht amortisieren können.
(Quelle: Tages-Anzeiger)
Sie bekamen den Verleider. Nicht den „Verleger“, also den für die Teppichware, und nicht den für die Bücher. Vielmehr kommt jemand zu ihnen und „verleidet“ etwas. Interessante Vorstellung, und garantiert durch und durch schweizerisch.
Bei Google-CH fanden wir ihn 627 Mal. Darunter auch den „Absoluten Verleider“ im Schweizer „ Beobachter“ (das ist kein Aktant, sondern eine Wochenzeitschrift).
Den technischen Verleider fanden wir beim Turnverein Bellach Schliesslich gibt es da noch den Verleider im aargauischen Gesetz über die Ausübung der Fischerei:
§ 16
1 Von den ausgesprochenen Geldbussen fällt ein Drittel dem Verleider zu.
2 Ist diese wegen Unvermögenheit des Gebüssten nicht erhältlich, so sollen dem Verleider wenigstens seine Anzeige- und gerichtlichen Erscheinungsgebühren vom Staate vergütet werden.
So ganz begriffen haben wir diese Paragraphen auch nach mehrmaliger Lektüre nicht. Sollten wir mal einen „Fürsprecher“ fragen, der kennt sich da bestimmt gleich aus, d. h. in der Schweiz „Er kommt (da) raus„, aus dem Fischteich oder was weiss ich wo das Leiden des Verleiders begann.
Ein wichtiger Mensch, dieser Verleider in der Schweiz. Wo der nicht alles gebraucht wird? Doch bevor wir es unseren Lesern nun verleiden, sich weiter mit dem „Verleider“ auseinanderzusetzen, hier die Lösung des Rätsels, wie so oft im Duden erklärt:
Verleider, der; -s, – (schweiz. mundartl.): Überdruss: er hat den Verleider bekommen (ist der Sache überdrüssig geworden).
(Quelle: Duden.de)
Nun ja, das mit dem „mundartlich“ wollen wir jetzt mal geflissentlich überlesen, denn er wird ja fleissig geschrieben, der Verleider. Warum auch nicht, ist doch so schön praktisch. Ein anderes Wort für „Überdruss“ also, so einfach ist das. Und wie schrecklich kompliziert das wieder auf Hochdeutsch ausgedrückt werden muss! „Er ist der Sache überdrüssig geworden“, daneben elegant schweizerisch: „Er hat den Verleider bekommen“.
Kein Wunder also, dass sich dazu in der Jugendsprache einiges entwickelte, von „kein Bock mehr haben“ über „gewaltig Frust schieben“ bis „voll auf den Blues gekommen sein„. Was wir hier so locker als „Jugendsprache“ bezeichnen ist mittlerweile auch veraltet und sicherlich durch neue Ausdrücke ersetzt worden.
An die armen „Verleger“ denken wir nicht mehr, bei all dem Überdruss, und reihen ihn ein, den freundlichen „Verleider“, gleich neben den „Aufsteller“, den „Ablöscher“ und meinetwegen auch den „Frank Baumann“ „Tätschmeister„.
Als Beispiel für richtig „gröhlendes Ablachen“ ein typischen Ablöscher-Sketch von Frank Baumann, live vorgestellt beim Arosa Humor Festival 2005. Aber dass hinterher niemand schreibt, ich hätte vor diesem Video nicht ernsthaft gewarnt!