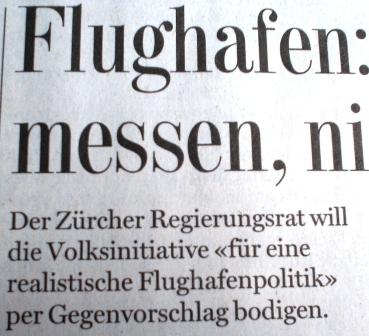Was Schweizer gerne essen (Teil 5) — Ein Pferdehüftsteak bitte!
Oktober 8th, 2012(reload 11.1.06)
Als ich noch ein deutscher Neuling in der Schweiz war, führte mich ein freundlicher Schweizer Kollege in ein grosses Migros-Selbstbedienungs-Restaurant zum Mittagessen (=„z’Mittag“). Die Warteschlangen beim Tagesmenü waren uns zu lang, also gingen wir zum „Grill-Corner“. Dort hing ein Schild „Heute Pferdehüftsteak“. Noch nie hatte ich gesehen, dass jemand in der Öffentlichkeit Pferd isst und dafür Werbung gemacht wird. Nun, wenn die Schweizer so was essen, dann wollte ich das auch mal ausprobieren, gemäss der alten Globetrotter-Weisheit:
„If in Rome, do like the Romans“. Also sagte ich schüchtern zum Grillmeister:
„Einmal das Pferdehüftsteak bitte“.
Wir wissen von Geissenpeter, dass die Deutschen immer alles „einmal“ haben möchten, um ganz sicher zu sein, dass da nicht plötzlich zwei Steaks auf den Teller wandern.
Nun, der Grillmeister drehte sich nach hinten um und brüllte laut in die Küche: „Pferdehüfsteak fertigmachen“, was natürlich zur Folge hatte, dass sich sofort die ganze Crew und alle anderen wartenden Kunden zu mir umdrehte und ich begafft wurde wie ein Menschenfresser. Man war das mega peinlich, so als Pferde-Esser geoutet zu werden! Scheint wohl doch nicht so üblich zu sein, hier Pferdefleisch zu essen.
Es dauerte ziemlich lange, bis das Steak auf den Grill kam, wahrscheinlich mussten sie erst noch das Pferd einfangen und dann schlachten, oder es wurde aus der hintersten Ecke des Kühlschranks geholt, was weiss ich.
Dann ging es ab zur Kasse, zu meiner Lieblingskassiererin, die uns immer mit einem freundlichen: „enguetedankegrueeziii“ begrüsste. Am Anfang ging ich davon aus, dass dies die übliche Verabschiedung an der Migroskasse sei. Aber die ist ja bekanntlich „Hen Sie Cumulus?„. Nein, ich kann mit Messer und Gabel essen. Obwohl im Migros-Restaurant ist Cumulus gar nicht erlaubt.
Meinen ersten Pferdemetzger sah ich in Allschwil bei Basel. Dort in der Nähe vom französischen Elsass haben die Schweizer kein Problem mit Pferdefleisch. Das meiste wird importiert:
Die GVFI International AG in Basel ist der grösste Fleischimporteur der Schweiz. 8200 Tonnen Schweinefleisch, 6700 Tonnen Rindfleisch, 4800 Tonnen Lamm, 4200 Tonnen Geflügel, 800 Tonnen Wild, 700 Tonnen Pferdefleisch importierte die GVFI im letzten Jahr und belieferte damit Detailhändler wie Migros und Coop, Metzgereien, Grossisten, Fleischverarbeitungsbetriebe. (Quelle: www-x.nzz.ch)
In der Schweiz wird Pferdefleisch schon lange importiert bzw. zu einem kleinen Teil für diesen Zweck gezüchtet:
Was für deutsche Betrachter als absolut exotisch und fremd anmutet, findet in der Schweiz seit Jahren zunehmende Bedeutung: Die Zucht von Schlachtpferden. Zwar ist der Anteil von Pferdefleisch, gemessen am Gesamtfleischverbrauch, mit ca. 1% auch in der Schweiz sehr gering, aber immerhin mußten schon immer recht hohe Mengen aus dem Ausland importiert werden. So stammen bis heute ca. 70% des Bedarfs vor allem aus den USA und Kanada.
(Quelle: members.aol.com/JSchwanke/fprods.htm)
Aber auch in Deutschland kann man Pferdefleisch kaufen:
Seit 1993 ist es in Deutschland gestattet, Pferdefleischprodukte gemeinsam mit anderen Fleischwaren zu verkaufen, so daß auch „normale“ Metzgereien Pferdefleisch im Angebot haben können. Einige, wenn auch nicht viele, machen von dieser Möglichkeit Gebrauch.
Quelle: (members.aol.com)
Also wollt Ihr es nun tun wie die Römer, wenn Ihr in Rom seid? Oder doch lieber nicht? Ganz nebenbei: Woraus ist eigentlich Jägerschnitzel, Zigeunerschnitzel oder Zürcher Geschnetzeltes?