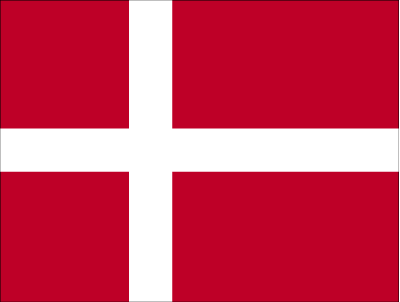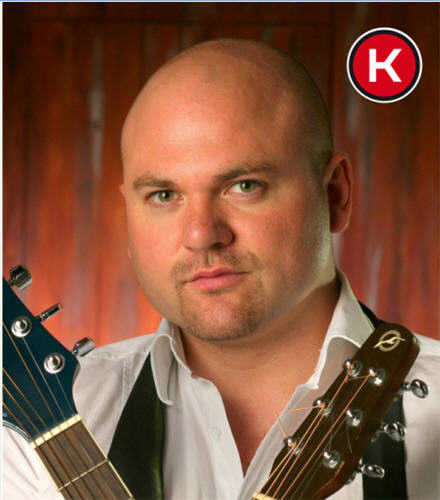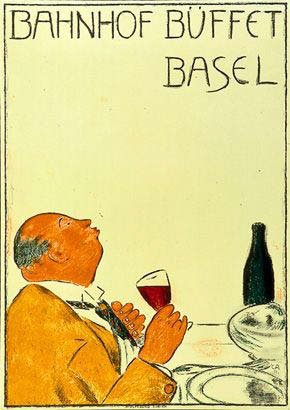Wo gibt es hier denn Elche? — Wenn die Schweiz in Schweden ist
Oktober 14th, 2008(reload vom 26.01.06)
Schweizer im Ausland haben ein Problem: Ihr Heimatland ist so schrecklich klein. Auf einem Globus ist es kaum zu sehen, und selbst auf einer Europakarte muss man es suchen. Dann sind da noch die verdammten Anfangsbuchstaben. Die Schweiz heisst auf Englisch „Switzerland“ und das fängt mit zwei exotischen Konsonanten hintereinander an: „SW-. Leider tun das die Namen von zwei anderen Ländern auch, so zum Beispiel „Sweden“. Und das kennt die Welt, besonders die amerikanische Welt. Denn einen Schweden gab es schon in der Muppet-Show, nämlich den Koch, der immer „Smörebröd, Smörebröd“ vor sich herbrummelte. Also wird die Schweiz wegen der gleichen Anfangsbuchstaben von den meisten Amis kurzerhand nach Schweden befördert.
Sie werden es kaum glauben, aber für diesen merkwürdigen Satz, sogar mit den Anführungszeichen drum herum, gibt es bei Google 92 Belege
Das bedeutet schlichtweg, dass 92 Mal an diversen Stellen im Internet ein armer Auslandsschweizer sich genötigt sah, seinen neuen Freunden zu erklären, dass die Schweiz nicht das Land ist, aus dem der Koch der Muppet-Show kommt und in dem man Elche treffen kann.

Elche gibt es auch im Schwarzwald (siehe Schwarzwaldelch von SWR3), aber nicht so weit im Süden, wie die Schweiz liegt.

Hier die Aussage einer Kanada-Schweizerin, die Mühe hat, ihren Wohnort zu erklären:
It seems for some strange reason, that whenever I say that I live in Switzerland, I’m asked how I like living in Sweden. Switzerland is not Sweden…so please quit asking me that!
Und die eines Schweizers, der das mit „Schweiz ungleich Schweden“ erklären muss:
Switzerland is NOT!!!! Sweden… Sweden is a country in northern Europe… Switzerland is famous for cheese, mountains, watchs, chocos…what more? ;)) but believe me there are lots of other things in Switzerland as well…Not everywhere in Switzerland are mountains!!! I don’t live in the mountains..: (and there are also very beautiful lakes and landscapes in Switzerland.)
Es gibt noch ein Land, das mit den Konsonanten SW- anfängt und so ähnlich heisst wie die Schweiz: „Swaziland“. Hier sind schon drei Konsonanten in der richtigen Reihenfolge sowie ein „–land“ vorhanden: „S-w-z-land“ Als ich mich einmal für eine Prüfung beim amerikanischen Online-Prüfungsanbieter PEARSON-VUE an einem Sonntag anmelden wollte, wählte ich die kostenlose Hotline in den U.S.A. Bei der Frage: „Which Country are you calling from?“ sagte ich gut gelaunt und nichts Böses ahnend: „Switzerland!“ Es wurde mir prompt „Swaziland? That’s fine…“ geantwortet.
Seitdem kann ich die Probleme der Schweizer verstehen, wenn sie im Ausland erklären müssen: „Switzerland is not Swaziland and not Sweden“. Ich erhöhte das Weltwissen der freundlichen Telefondame von Pearson-Vue, in dem ich sie darüber aufklärte, dass die Entfernung von Swaziland nach Switzerland nur knapp 8.470 Km beträgt (Quelle:), also praktisch ungefähr die Distanz, die sie auch für ein Wochenende zum Skifahren in Colorado in den Rocky Mountains zurücklegt.
Flagge von Swaziland:

Flagge von Schweden

Merke! Die Flagge der Schweiz zeigt ein Kreuz, und sie ist Weiss und Rot!