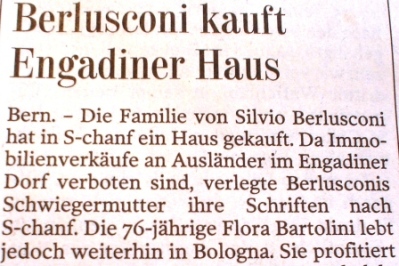„Einmal“ in Bern, „manches Mal“ auch im Oberland
Mai 6th, 2006Wer als Deutscher in die Schweiz kommt und anfängt, sein Hörverständnis für die Schweizerdeutschen Dialekte (=Sprach-Varianten) zu trainieren, wird früher oder später über diese hübschen Wörter stolpern, die vor allem im Kanton Bern häufig zu hören sind:
Nein, das Wort ist wirklich keine ultraverkürzte Form, mit verschlucktem „heim“ in der Mitte. Ganz im Sinne der dichtbesiedelten Schweiz mit ihrem Gebot, sorgsam und platzsparend mit jeder Fläche umzugehen. „Einisch“ heisst „einmal“, und es wird auch nicht nur einmal geschrieben. So finden sich bei Google-Schweiz 59.400 Erwähnungen. Das Wort wird in der ganzen Schweiz verstanden, aber nicht überall gleich ausgesprochen. Schon im Berner Oberland mutiert es zu „iinisch“.
Die Schreibweise mit „ei“ am Anfang hat gemäss Aussage eines Berners, den wir dazu befragten, rein gar nichts zu sagen. Er versichert uns, dass dies in Bern wie „ä“ ausgesprochen wird. „Wänn äs näch dän Bärner gänge, kännte män sowieso auf älle „Eis“ verzichtän und nur noch „äh“ sprächen und schräbän“, sagt der Berner und lächelte dabei. Natürlich mit „ä“. Der will uns bestimmt auf die Schippe nehmen. Wir wissen ganz genau, da sind noch jede Menge „ou“ und „u“ im Berndeutschen. Für uns klang das mehr nach dem „Seele-Fant“ aus der Augsburger Puppenkiste Serie „Urmel aus dem Eis„.
Wir stellten fest, dass es ungefähr 12 Aussprachemöglichkeiten von Lauten zwischen e-ee-ei-ä-eä-iä gibt, die sich kaum mit dem beschränkten Lateinischen Alphabet niederschreiben lassen.
Das Wörtchen „einisch“ dann konsequent auch mit „ä“ als „ähnisch“ zu schreiben, fiel den Bernern nicht ein. Denn das erinnerte dann doch wieder zu stark an „eher nicht“. Und „einisch“ ist doch „eher doch“ nämlich „ein Mal“ zumindest. Zu „einisch“ passt noch ein zweites Wort, dass ebenfalls aus Bern stammt:
Hat es was mit „Mengen“ der „Mengenlehre“ zu tun, oder mit „Männern“? Wenn Weiber „weibisch“ sein können, warum sollten in der Schweiz nicht auch Männer „mängisch“ werden? Solchen Ideen gehen uns als Deutsche durch den Kopf, bis wir das Wort endlich dank des Kontextes, in dem es permanent verwendet wird, verstehen können. Mani Matter sei Dank! So in seinem Lied „D Nase“:
Loset mit was für Methode
Mängisch ds Schicksal eim tuet schla
Loset mit was für Methode
Mängisch ds Schicksal eim tuet schla
Zumnen Arzt isch eine cho dä
Het e zlängi Nase gha
Het e zlängi Nase gha
(Quelle: geocities.com)
Oder im Lied „Hemmig“:
I weis, das macht eim heiss, verschlat eim d’Stimm
Doch dünkt eim mängisch o s’syg nüt so schlimm
S’isch glych es Glück, o we mirs gar nid wei
Das mir Hemmige hei
(Quelle: geocities.com)
Und in „Mir hei e Verein“
Mir hei e Verein, i ghöre derzue
Und d’Lüt säge: Lue dä ghört o derzue
Und mängisch ghören i würklech derzue
Und i sta derzue
Mänggisch sollte laut alter Berndeutsch Schreibung eigentlich mit zwei „g“ geschrieben werden, sagt unser Berndeutsch Spezialist. Bei Google-Schweiz finden sich jedoch fast nur Verwendungen der knappen Form „mängisch“, dass dafür sensationelle 49.800 Mal!
Wir erinnern uns an die ständig gehörte Feststellung, dass Schweizerdeutsch nur eine gesprochene Sprache ist, abgesehen von Liedtexten bei Mani Matter, SMS und E-Mail. Wie kommen dann die fast 50.000 Einträge in Google zustande? Gibt es Berner, die ihre E-Mails von Google erfassen lassen?
Nein, aber es gibt dafür Menschen, die statt mängisch lieber mengmal sagen. Die kommen dann in der Regel aus dem Berner Oberland. Die restlichen 23 regionalen Versionen von „manchmal“ im haben wir dann nicht mehr weiter gesucht.