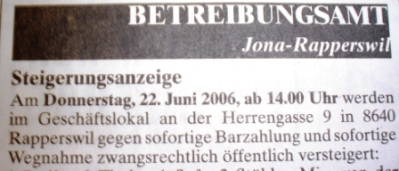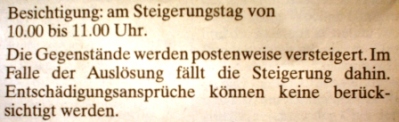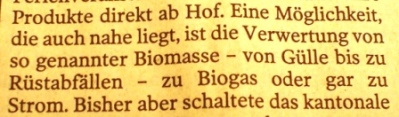Ein Volk von Fallenstellern — Fallenmacher unter sich
Juli 2nd, 2006Das Wort „Falle“ hat es den Schweizern „im Fall“ wirklich angetan. Wir berichteten schon ausführlich, was „im Fall“ alles geschehen kann: (vgl. Blogwiese )
Da entdeckten wir auf dem Blog des Moderators Aeschbacher diesen hübsche Redewendung:
ps: ich hätt euch gerne ein paar bilder gezeigt von diesem einsatz. aber mir wurde die kamera geklaut und drum müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen, welche falle ich als kehrichtlader mache.
(Quelle aeschbacher.blog)
Aeschbacher hat einen Tag lang als Müllmann gearbeitet. Der Job heisst in der Schweiz offensichtlich „Kehrrichtlader“. In meiner Kindheit nannte ich diesen Job „Mülltonnenwagenhintendraufsteher“, und selbstverständlich war das ein Traumjob. Hinten am Müllwagen auf dem Trittbrett stehen und cool aus der Wäsche gucken. Ich wurde dann tatsächlich mal Leerer, nicht mit ohne „h“ als Leerer der Mülltonnen, sondern mit mit „h“ als Lehrer für Schüler. Der Job ist aber an sich sehr ähnlich.
Aeschbacher macht in diesem Zusammenhang eine „Falle“. Und er ist nicht der einzige:
Als PC-Bildschirm dürfte er höchstwahrscheinlich ebenfalls eine gute Falle machen, ausprobiert hab ich’s nicht.
(Quelle: digitalsushi)
Oder hier in einer Filmkritik:
Lourdes‘ Familie würde in einem Film der Coen-Brüder eine gute Falle machen und ein Prise Sex darf auch nicht fehlen
(Quelle: outnow.ch)
Zum Glück kann auch diesmal unser Variantenwörterbuch das Geheimnis lüften, ob die Schweizer ein Volk von Fallenstellern sind:
[k]eine schlechte Falle machen
[nicht] schlecht dastehen oder aussehen, [k]einen schlechten Eindruck machen: Für die Zukunft empfiehlt D. der CVP einen Mitte-Rechts-Kurs. In der Europafrage habe man eine schlechte Falle gemacht (Metropol3.5.2001, 2
(Quelle Variantenwörterbuch S. 230)
Aber eigentlich sind wir doch enttäuscht. Die Redwendung wird zwar erklärt, dennoch erfahren wir nicht, woher sie kommt.
In meiner Heimat heisst „in die Falle gehen“ auch, dass man sich zu Bett begibt, und nicht, dass man hineingefallen ist. Dafür gibt es nebenbei bemerkt noch ein paar weitere nette Wendungen:
knacken gehen
pofen gehen
auf die zwei Meter gehen (Funker-Jargon, die sprechen über das 2-Meter-Band)
Matrazenhorchen gehen
Vielleicht hat es ja mit dem Latein oder Schriftdeutsch Unterricht zu tun, wenn es darum geht, Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ gut auseinander zu halten und so gute „Fälle“ zu machen. Aber es heisst „Falle machen“ und nicht „Fälle machen“. Oder sind es eigentlich „Felle“, wie Tierfelle, die da gemacht werden? Und es ist ein Überbleibsel aus dem Kürschner-Handwerk.
„Für einmal“ wissen wir nicht was wir „in dem Fall“ schreiben sollen und schliessen mit Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ Zitat:
Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen / Den Vorhang zu und alle Fragen offen.“