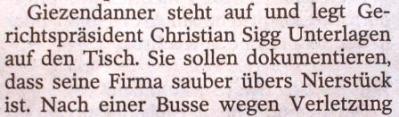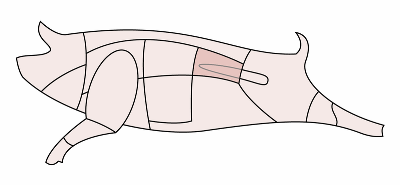Es „sich“ gewohnt sein
Studenten in Deutschland sind einiges gewohnt, was ihre Mahlzeiten in der „Mensa“, dem studentischen Mittagstisch angeht. Anders als die Schweizer können sie beim „gewohnt sein“ nicht noch ein „sich“ einfügen. Ihre Schweizer Mitstudenten hingegen sind „sich“ einiges gewohnt. Beim Überqueren des Rheines in Richtung Norden säuft dieses „sich“ dann ab. Es existiert in Deutschland beim „gewohnt sein“ nicht. Oder hat es „sich“ einfach dünne gemacht und ist zum Wetter geflüchtet, das „sich“ in Deutschland, anders als in der Schweiz, ständig reflexiv ändert?
Stammessen und Nachschlag
Studenten sind „sich“ einiges gewohnt, sie müssen in einer Mensa nämlich „Stammessen“ essen. Das sind jetzt keine Baumstämme, oder nach Volksstämmen sortierte Angebote, sondern schlicht eine Auswahl zwischen „Eins“ und „Zwei“. So heissen die Warteschlangen zu den Fliesbändern der Massenabspeisungen in der Universität. Wem die normale Portion beim Essen nicht reicht, der muss noch mal zurück und sich einen „Nachschlag“ holen.
Nachschlag auch bei den Staumeldungen
Das tut nicht weh und macht extra satt, eine ordentliche Portion „Sättigungsbeilage“, wie man im Osten das offiziell nannte. Da viele Menschen in Deutschland studieren und anschliessend als Soziologen oder Deutschlehrer auf der Strasse stehen ohne Job, gehen diese Menschen zum Beispiel zum Radio, um Moderator zu werden. Und so kommt es, dass beim Sender SWR3 aus Baden-Baden, der bis weit in die Schweiz gut zu empfangen ist, permanent vom „Nachschlag“ geredet wird, wenn nach der Verlesung der morgendlichen Staumeldungen noch eine Information nachgeliefert wird: „Ich habe da noch einen Nachschlag….“
Wir fragen uns dann als Hörer immer, in welcher Mensa diese Moderatoren früher nicht satt wurden, wenn sie heute noch vom Nachschlag träumen.
Aus „Nachschlagen“ wird die „Nachschlagung“
Für die Schweizer ist das Verb „nachschlagen“ und sein Substantiv, das „Nachschlagen einer Information“ offensichtlich zu kurz. Es klingt tönt nicht schön in ihren Ohren, da muss doch noch was dran. Jawohl, ein „-ung“ wäre fein.
Das hübsche Wort findet sich in vielen Gesetzestexten und Anleitung. So lasen wir hier beim Justiz-Departement des Kanton Solothurn unter der Überschrift: „Eintragung von Dienstbarkeiten und Grundlasten im Grundbuch“ die Anleitung:
4. Attribute, wie „unbedingt“, „ungehindert“, „beschränkt“, „unbeschränkt“, usw., sind für den Hauptbucheintrag nicht zu verwenden, denn sie sind in der Regel für die nähere Bestimmung des Inhaltes der Dienstbarkeit oder Grundlast, weil sie zu dessen Feststellung die Nachschlagung des Grundbuchbeleges nicht entbehrlich machen, belanglos.
(Quelle)
Voller Anerkennung verleihen wir auch bei diesem Text für die Verwendung des doppelten Genitivs („des Inhalts der Dieinstbarkeit“ und „dessen Festlegung die Nachschlagung des Grundbuchbeleges“) unser Ehrenabzeichen am Goldenen Bande.
In Deutschland wird das Wort „Nachschlagung“ nur im staubtrockenen Deutschen Rechtswörterbuch DRW erwähnt, aber nicht in echten Texten, zusammen mit
dem Nachschlagungsprotokoll,
dem Nachschlagungsrecht,
dem Nachschlagungszug und
dem Nachschlagsverfahren.
(Quelle: DRW)
Wir anerkennen auch hier neidlos die juristische Kreativität.
Sie wollen zum Rütli? Dann bitte hier den Antrag ausfüllen und unterschreiben!
Entdeckt haben wir das hübsche Wort in einem Artikel des Tages-Anzeigers vom 04.06.06 über die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG, welche in diesem Jahr für das Anmeldeprozedere zum Nationalheiligtum Rütli zuständig ist. Wer dort am 1. August hinfahren möchte, braucht ein Ticket, dass mit diesem Formular beantragt werden muss.
Darin heisst es:
Das Antragsformular muss leserlich, vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt werden.
Unleserliche Antragsformulare und Antragsformulare, die nicht vollständig und/oder nicht wahrheitsgetreu ausgefüllt sind, werden ohne Benachrichtigung nicht zugelassen.
Die Veranstalter behalten sich vor im Zweifelsfall die auf dem Antragsformular aufgeführten Personen durch Nachschlagung in den polizeilichen Datenbanken zu überprüfen.
Die Karten sind persönlich und nur mit einem Personalausweis gültig.
Wenn das die Radaubrüder vom letzten Jahr noch nicht genug abschrecken sollte von ihren bösen Plänen, dann sicherlich der letzte Absatz dieses Antragformulars:
Ich/wir verpflichte mich/uns, die Bundesfeier am 1. August in keiner Weise zu stören und mich/uns an die Hausordnung der Rütlikommission der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft zu halten, bzw. dass ich/wir mich/uns an die Weisungen der Polizei und des Ordnungsdienstes halten werden.
Ort und Datum: Unterschrift:
(Quelle: sgg-ssup.ch)
Ein Mann, ein Wort. Ein Rütlifest, ein Formular. So nimmt der friedliche Geist des Treffens auf der Rütliwiese endlich Gestalt an. Wir fragen uns, warum man nicht früher auf diese Idee gekommen ist. Einfach alle Besucher auf dem Weg zur Rütli diesen Zettel unterschreiben lassen, und schon ist Ruhe auf der Wiese. Dass die Schweizer Behörden auf solche genialen Ideen aber immer erst so spät kommen. Was hätte alles damit im letzten Jahr verhindert werden können!