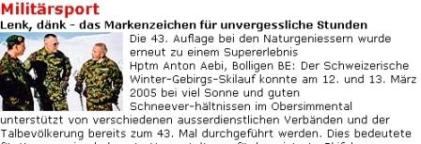Wie distanziert und verschlossen sind die Schweizer?
Juni 7th, 2010In der NZZ am Sonntag vom 30. Mai 2010 schrieb Haig Simonian, seines Zeichens Schweiz-Korrespondent der Financial Times, über die Schweizer, die den direkten Kontakt scheuen:
Die Schweiz geniesst unter Ausländern allergrösstes Ansehen. Während die Einheimischen auf Dinge wie Pünktlichkeit und Sauberkeit achten, schätzen Ausländer vor allem politische Stabilität, Wohlstand und Sicherheit. Doch in einer Hinsicht schneidet das Land nicht so gut ab: Die Schweizer gelten bei vielen Menschen als distanziert, ja verschlossen.
An Erklärungen mangelt es nicht. Aussenstehende verweisen gern auf das Klischee von der Mentalität des Bergvolks, das, von der harten Natur geprägt, im Laufe der Jahrhunderte gelernt hat, nur den unmittelbaren Nachbarn zu trauen und Fremden gegenüber misstrauisch zu sein. Andere sprechen von der typisch «alemannischen» Arbeitsamkeit und Schwerfälligkeit, der man auch in Baden-Württemberg und Vorarlberg begegne.
(Quelle für dieses und alle weiteren Zitate: NZZ am Sonntag vom 30.05.2010)
Arbeitsamkeit ja, aber Schwerfälligkeit? Wie wäre dann das alemannischer Tüftlertum mit Daimler, Benz, Porsche oder der Uhrenindustrie zu erklären? Sicher nicht mit Schwerfälligkeit.
Diese Klischees sind, wie jede Verallgemeinerung, im Detail natürlich unhaltbar. Vor allem ist die Schweiz nicht ein Land, sondern, nach Sprache und Kultur, mindestens drei. Das Image, sofern es überhaupt zutrifft, gilt also mehr für die Deutschschweizer als für den Rest des Landes.
Immerhin stellt er hier fest, dass die Deutschschweizer nicht gleichzusetzen sind mit der ganzen Schweiz.
Ich selbst würde sagen, dass sich die Verschlossenheit der Deutschschweizer typischerweise darin äussert, dass man den direkten verbalen Kontakt meidet und lieber schriftlich kommuniziert. Meine Einschätzung ist natürlich vollkommen subjektiv. Ich habe keine Analysen gelesen, keine Soziologen befragt, und vielleicht liege ich auch total daneben. Aber ich glaube eigentlich nicht.
Wir können hier als bestes Beispiel die „Zettelkommunikation“ in der Waschküche anführen. Lieber zweimal neue Zettel aufgehängt als einmal beim Nachbar geklingelt und die Sache von Angesicht zu Angesicht besprochen.
In keinem der europäischen Länder, in denen ich gelebt und gearbeitet habe (Deutschland, Italien, Frankreich und Grossbritannien), bin ich Menschen begegnet, die im persönlichen Umgang so gehemmt sind und gern Distanz wahren. Im Büro etwa bekomme ich täglich über hundert E-Mails, aber kaum jemand ruft an. Anderswo klingelte dauernd das Telefon.
Das kann natürlich mit der technischen Entwicklung zusammenhängen. In den letzten sechs Jahren hat der E-Mail-Verkehr sprunghaft zugenommen. Dass in der Schweiz, einem hochtechnisierten Land mit grosser Breitbanddichte, die Leute lieber Mails schicken, als zum Telefon zu greifen, ist eigentlich kein Wunder. Vielleicht wollen manche einfach nur höflich sein und mir nicht zumuten, Deutsch zu sprechen (was ich kann), oder möglicherweise fühlen sie sich unwohl, wenn sie Hochdeutsch oder gar Englisch sprechen müssen.
Wer in einem Büro sitzt, in dem Verkäufer damit beschäftigt sind, via Telefon ihre Ware oder Dienstleistung zu verkaufen, wird hier eine andere Beobachtung machen. Mails haben Telefonate tatsächlich weitgehend verdrängt, weil man seine Gesprächspartner sowieso nicht erreichen kann am Telefon, und irgendwann die Nase voll hat vom ständigen Nachrichten hinterlassen auf den Anrufbeantwortern, die in der Schweiz nur „Beantworter“ heissen, kurz und knapp.
Doch ich glaube, es ist mehr. Nach sechs Jahren Schweiz bin ich überzeugt, dass vielen Deutschschweizern der direkte Kontakt unangenehm ist. Man schaue nur, wie viele von ihnen unfähig sind, auch nur den harmlosesten Smalltalk zu führen.
Aber seit wann ist denn ein Telefongespräch ein direkter Kontakt? Ich glaube nicht, dass den Schweizern der „direkte Kontakt“ unangenehm ist, jedoch die „direkte Kontaktaufnahme“, ohne Vorspiel, Ritual und langsames Herantasten an den Gesprächpartner.
Ausländischen Mitarbeitern von multinationalen Unternehmen fällt die geringe Bereitschaft der Deutschschweizer auf, bei Sitzungen ihre Meinung zu sagen. Sie mögen klare Ansichten haben; sie behalten diese aber lieber für sich – aus Unsicherheit, aus Angst, anderen zu nahe zu treten, oder weil in ihrer Kultur der Konsens eine grosse Rolle spielt. Bei Ausländern kommt das leicht – und verständlicherweise – als Unfreundlichkeit, wenn nicht gar als Fremdenfeindlichkeit an.
Klassische Schweizer Zurückhaltung par excellence. Nicht aus Angst, sondern weil man es nicht nötig hat, sich gross in Szene zu setzen. Suter hat dort darüber in seinen Business Class Glossen tolle Erkenntnisse geliefert, siehe hier.
Tatsächlich ist das Bild komplexer. Den Klischees widerspricht beispielsweise die bemerkenswerte Offenheit in anderen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft, etwa die Akzeptanz von Ausländern auf Führungspositionen in Unternehmen, Universitäten oder Kultureinrichtungen.
Dies hier beobachtete „bemerkenswerte Offenheit“ und „Akzeptanz von Ausländern auf Führungspositionen“ ist wunderbar beobachtet, aber falsch interpretiert. Nur weil beim ESC die Schweiz für Lena 12 Punkte schickte, heisst das noch lange nicht, dass Schweizer für Lena gestimmt haben (es waren eher die 260 000 Deutschen im Lande). Nur weil da Ausländer in Führungspositionen sitzen, heisst das noch nicht, dass sie akzeptiert sein müssen. Ich würde da eher von „aus der Not eine Tugend machen“ sprechen. Denn wenn sonst kein Kader im eigenen Land zu finden ist, der die notwendige Qualifikation und Erfahrung mitbringt, dann wird halt in Gottes Namen ein Ausländer akzeptiert. Und Gott ist ein Schweizer, das wissen wir seit langem.
Ich weiss auch, dass dieselben Leute, die in ungewohnter Umgebung wenig kommunikativ und zugeknöpft wirken, in vertrauten Situationen ganz anders sein können. Historisch war das vielleicht ihr Bergdorf, heute dürfte es der Verein, der Klub oder das Quartier sein.
In unserem Quartier organisieren die Nachbarn seit Jahren allsommerlich ein Strassenfest. Es ist eine rein private Initiative, unabhängig von der Stadt, ohne Bezug zu einer Partei oder einem Klub. Die Atmosphäre ist entspannt, die Leute reden miteinander und riskieren sogar, mit «Fremden» ins Gespräch zu kommen. Das alles ist höchst «unschweizerisch».
Da sind wir wieder bei den alemannischen Schwaben und ihrer „Hocketse“ Feier einmal im Jahr. Da löst sich nach dem dritten Viertele schon die Zunge und es wird direkt und persönlich gefragt: „Henn Sii schoo geerbt? Henn Sii schoo gebaut?“ Alles doch nicht so anders als wie in der Schweiz, in Deutschland.