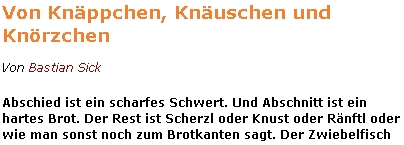(reload vom 24.08.06)
Vom Dialekt zur Standardsprache
Es erzählte uns ein Deutscher vom Niederrhein, dass er erst in der 5. Klasse des Gymnasiums mit Hochdeutsch konfrontiert wurde. Die Familie, die Freunde, selbst die Lehrer in der Grundschule sprachen in der Regel Dialekt, also auf Plattdeutsch. Es wurde ab der Grundschule auf Hochdeutsch geschrieben, jedoch nicht gesprochen. Diktate gehörten mit zum Schwersten für ihn. Erst im Gymnasium lernte er wie es ist, sich nur noch auf Hochdeutsch zu verständigen. Er lernte die „Hochsprache“ kennen als ein geregeltes System, mit dem sich zwei Hauptfunktionen von Sprache erfüllen lässt:
1. Kommunikation mit anderen, die auch diese Standardsprache sprechen
2. Speicherung von Information in schriftlicher Form
Jede Sprache kann Wissenschaftssprache sein
Um in einer Sprache einen Gedankengang entwickeln zu können, muss die Möglichkeit bestehen, in ihr Begriffe zu definieren und Bedeutungen festzulegen. Jeder Philosoph wird nicht umhin kommen, zunächst festzulegen, welche Fachwörter er verwenden möchte und wie sie für ihn umgrenzt sind.
Das liegt an der „Beliebigkeit“, der „Arbitrarität“ von sprachlichen Zeichen. Ein und dasselbe Gemüse wird von den Schweizern „Peperoni“ und von den Deutschen „Paprika“ bezeichnet. Die Festlegung ist nur innerhalb einer Sprachgruppe oder einer Fachsprache gültig. Wären die sprachlichen Zeichen innerhalb einer Sprechergruppe beliebig, könnte Kommunikation nicht funktionieren. Erst wenn die Begriffe definiert sind, kann in jeder Wissenschaft damit gearbeitet werden. Bei manchen Wissenschaften funktioniert das besser als in anderen. So wurde in der Mathematik genau festgelegt, was ein Produkt oder eine Summe ist. Doch schon das Wort „Produkt“ hat in anderen Wissenschaften eine ganz andere Bedeutung. Die Linguisten streiten darüber, was „Sprache“ ist und allein der Begriff „Wort“ hat es auf etliche Definitionen gebracht.
Bestimmt die Sprache die Art des Denkens?
Können wir klarer formulieren, klarer denken, anders denken wenn wir uns einer genormten Standardsprache bedienen, als wenn wir dies in einem nicht standardisierten Dialekt tun? Ist die Philosophie von Kant oder Descartes eine andere, wenn Sie nicht mehr in der ursprünglichen Sprache, sondern in einer Übersetzung gelesen wird? Zu mindestens Kant baut ein höchst komplexes Geflecht von Begriffen wie „Sein“ und „Wesen“ und „Gewesensein“ etc. auf, dass sich nur schwer adäquat auf Englisch übersetzen lässt.
Das es einen Zusammenhang zwischen „Sprache und Denken“ gibt, wurde vor allem durch die Sapir-Whorf-Hypothese behauptet:
Die Sprache ist nicht als eine Leistung zu verstehen, die das Denken unterstützt, postuliert Benjamin Lee Whorf in seinem Werk „Denken, Sprache, Wirklichkeit“ (1963). Sie schreibt uns vielmehr vor, was wir zu denken haben und auch, was wir tatsächlich denken. Nach Whorf ist ein Denken ohne Sprache gar nicht vorstellbar. Es gibt kein Denken, das sich nicht in den syntaktischen Strukturen unserer Sprache vollzieht.
Die Hypothese, die sich mit der Abhängigkeit von Sprache und Denken befaßt, wurde maßgeblich von drei Persönlichkeiten geprägt: Franz Boas, Edward Sapir und Benjamin Lee Whorf. Sie ist noch heute umstritten und bietet Ansätze für zahlreiche Untersuchungen.
(…)
Edward Sapir (…) war der Ansicht, daß die Denkprozesse des Menschen durch die Eigenheiten seiner Sprache strukturiert und gesteuert werden. Er glaubte also an eine direkte Beeinflussung des Denkens durch die Sprache. Die Eigenheiten und Einstellungen, so meint er, sind Resultat spezifischer Sprechweisen. Sprache wird in dieser Theorie zum Spiegel sozialer Wirklichkeit. Dies leitet er aus der Beobachtung ab, daß es keine Sprachen gibt, die einander so ähneln, daß sie annähernd gleiche soziale Realitäten wiederspiegeln können.
Benjamin Lee Whorf, (…), vertrat die radikalste Position. Seiner Meinung nach sind sogar die grundlegendsten menschlichen Begriffe wie Raum, Zeit oder Materie ein Resultat der Sprache. Diese Begriffe sind relativ und haben für Menschen unterschiedlicher Sprachräume ganz unterschiedliche Bedeutung. Whorf macht diese Annahmen mehrfach am Vergleich der Sprache durchschnittlicher Europäer (SAE – Standard Average European) und der von Hopi-Indianern deutlich.
(Quelle: hausarbeiten.de)
Denkt man auf Schweizerdeutsch anders als auf Hochdeutsch?
Sprecher von Sprachen mit anderen Begriffen von Vorzeitigkeit, von Zukunft, von Konditionalis etc. nehmen die aussersprachliche Wirklichkeit nicht in gleicher Weise auf wie Sprecher von SAE, dem „Standard Average European“. Denken Sie dadurch auch anders? Kunstwissenschaftler sagen gern: „Der Mensch sieht (in der Kunst) nur das, was er kennt“. Eskimos haben mehr Wörter für die Arten des Schnees als Europäer, für Wüstenbewohner gibt es etliche Wörter für Sand, Weinkenner gebrauchen etliche Adjektive für ihren Wein, der für Norddeutsche nur süss oder trocken, rot oder weiss ist, und Schweizer haben zwanzig Wörter für die Tätigkeit „arbeiten“.
Der Wortschatz von Dialekten kommt in der Regel mit der permanenten Entwicklung des Wortschatzes in der Standardsprache nicht nach. Zwar füllt das Idiotikon der Schweizer Dialekte bald 16 Bände, darin werden sie aber kaum neue Schweizer Formen für „Leasing“, „googlen“ oder „MP3-Player“ finden. Die Wortfelder, in denen Dialektwörter noch stark differenziert sind, stammen zumeist aus dem häuslichen Umfeld oder der Landwirtschaft und gehen, mit der abnehmenden Bedeutung dieser Lebensbereiche, immer mehr in Vergessenheit.
Wie lösen Gehörlose Menschen mathematische Probleme?
Von Gehörlosen weiss man, dass ihre Gebärdensprache nicht identisch ist mit der Normalsprache, sondern hinsichtlich Grammatik und Syntax stark vereinfacht wird. Das kann jeder beobachten, der bei einem Fernsehfilm die Untertitel für Gehörlose einblendet. Die gesprochenen Dialoge werden vereinfacht wiedergegeben, Zeiten und Nebensatzkonstuktionen sind weniger komplex. Dennoch können diese Menschen viele Berufe erlernen, Autofahren, mathematische Probleme lösen und sind auch sonst zu Abstraktionen fähig, auf Basis ihrer Sprache.
Kant auf Schweizerdeutsch diskutieren?
Für eine homogene Sprechergruppe von Schweizern, die sich auf einen gemeinsam verwendeten Dialekt verständigen kann, sollte das möglich sein. Knifflig wird es nur, wenn dann in der Standardsprache definierte Fachwörter in die Diskussion einfliessen. Wir erleben im Gespräch mit Schweizern regelmässig, wie dann überlegt wird, ob ein Fachwort nun auf Hochdeutsch oder in Mundart ausgesprochen werden soll. Es entsteht dann eine kleine Verzögerung im Sprachfluss. Die Folge ist eine Mischform, wie man sie in der Schweiz sehr häufig zu hören bekommt. Dialekt durchsetzt mit hochdeutschen Wörtern.
Wenn es ans Verschriften der Beiträge geht, ist die Verwendung der Standardsprache wieder einfacher. Kleine Fingerübung zum Schluss: Versuchen Sie doch mal Kants Definition von „schön“ und „erhaben“ in ihren Dialekt zu übertragen und niederzuschreiben:
„Schön ist das, was in bloßer Beurteilung (also nicht vermittelst der Empfindung des Sinnes nach einem Begriffe des Verstandes) gefällt. Hieraus folgt von selbst, dass es ohne alles Interesse gefallen müsse. Erhaben ist das, was durch seinen Widerstand gegen das Interesse der Sinne unmittelbar gefällt.“
(Quelle: Wikipedia)
Anschliessend lesen Sie einem Sprecher ihrer Sprachgruppe diesen Satz vor. Erst auf Dialekt, dann auch Hochdeutsch. Messen Sie dabei die Zeit, die er andere benötigt, um den Satz aufzufassen und zu verstehen. Wenn sich das überhaupt messen lässt, aber Sie merken sicherlich schon, worauf das hinausläuft. Es denkt sich doch rascher auf Hochdeutsch, oder?