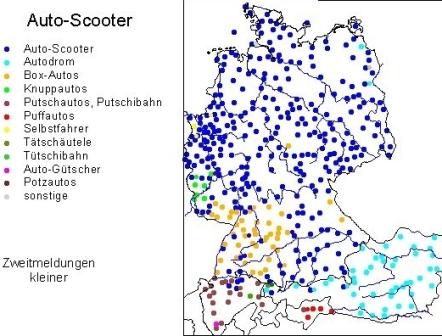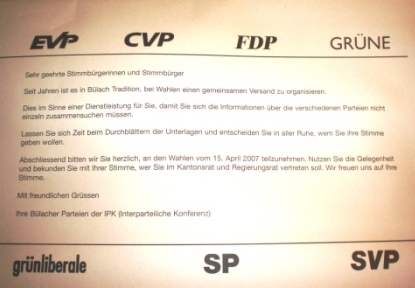Am Anfang fragten noch alle
Als wir vor 9 Jahren in die Schweiz kamen, wurden ich noch oft gefragt: „Verstehen Sie Schweizerdeutsch, oder soll ich Hochdeutsch sprechen?“ Worauf ich dann meist nach zwei Minuten mit der Frage: „Verstehen Sie Hochdeutsch, oder soll ich Schweizerdeutsch sprechen?“ konterte. Das war natürlich als Scherz gemeint, da ich Schweizerdeutsch erst nach dem dritten Glas Wein spreche. Dafür dürfen Sie dann auch wählen zwischen Bärndütsch oder Züridütsch. Ab dem vierten Glas Wein käme dann noch Walliserdütsch hinzu.
Nüchtern hingegen entgegne ich: „Verstehen Sie Hochdeutsch, oder soll ich Schweizerdeutsch zuhören?“, denn das kann ich inzwischen fliessend.
Es ist immer das gleich Problem in der Schweizer-Deutschen Kommunikation, vor dem die Deutschschweizer stehen, die mit ihrer perfekten Diglossie (Zweisprachigkeit) zwischen der Standardsprache und ihrer Variante des Hoch- oder Höchstalemannisch wechseln können.
Obacht vor den zweisprachigen Deutschen!
Es gibt zwar eine wachsende Zahl von Deutschen, die ebenfalls zweisprachig geworden sind und Schweizerdeutsch sprechen, aber es muss schon ein ziemlicher Zufall sein, an einen solchen zu geraten. Die meisten Vertreter dieser seltenen Spezies tarnen sich so geschickt, dass sie von den Schweizer nicht mehr als „Dütsche“ wahrgenommen werden. Der Schockeffekt ist um so grösser, wenn sich plötzlich einer outen und in einer Diskussion bekennen: „Auch ich bin ein Deutscher!“
Dann fragte irgendwann niemand mehr
Nach einer Weile hörte das auf mit der Fragerei, ob wir Schweizerdeutsch verstehen. Als klar war, dass wir hier auf Dauer leben und zum Bruttosozialprodukt beitragen, und keine Manager mit Geldkoffer auf Kurzbesuch sind, die hier nur ein Rendezvous mit ihrem Kundenberater haben (siehe hier: „Schwarzgeld verstecken in der Schweiz“), sprach man mit uns nur noch Schweizerdeutsch. Ungefragt. Und wir hörten zu und verstanden alles, oder jedenfalls fast alles. Täglich ein kleines bisschen mehr. Es ist lernbar, und höllisch interessant obendrein.
Als Tourist wird man nie gefragt
Als wir dann im Sommer die Schweiz per Velo durchquerten, da schien uns jemand mit einem dicken Stempel den Schriftzug „ACHTUNG: TOURISTEN AUS DEUTSCHLAND“ auf die Stirn gedrückt zu haben, denn plötzlich sprachen alle, egal wo wir hinkamen, ausschliesslich Hochdeutsch mit uns. „Das sind Touristen, da machen wir keine Umstände, die müssen bei Laune gehalten werden, damit sie wiederkommen“. Und was hält Touristen mehr bei Laune als ein zünftiges Schweizer Hochdeutsch à la Emil Steinberger, den sie doch alle so gut kennen?
Hundertausend Mal haben wir diese Anekdote erzählt bekommen: „Und dann sagt der Deutsche zu mir: Ihr Schweizerdeutsch verstehe ich sehr gut! Und ich sag zu ihm: Aber ich habe doch nur in meinem besten Hochdeutsch mit Ihnen gesprochen!“ Es ist keine Anekdote, es ist brutal erlebter sprachlicher Alltag zwischen Deutschen und Schweizern in der Schweiz.
Sprechen Sie ruhig Schweizerdeutsch mit mir
Das sagen viele Deutsche, die Schweizerdeutsch gut verstehen oder es verstehen lernen wollen. Sie schaffen damit eine gewisse Gelöstheit bei ihrem Schweizer Gegenüber. Endlich fällt das förmliche „Korrektsprech“ von ihm ab, und er kann schnurren wie ihm der Schnabel gewachsen ist wie es aus dem „Muul“ kommt, und braucht dabei keine Angst zu haben sich zu blamieren. Gleichzeitig wird ihm die Chance genommen, ein lockeres Alltags-Standarddeutsch zu pflegen und zu üben. Also rostet es ein und verkommt zur holprigen Sprache „für den besonderen Anlass“, z. B. bei Interviews fürs Fernsehen. So antworten beim Schweizer Fernsehen in der Sendung 10 vor 10 viele Befragte konsequent auf Hochdeutsch, auch wenn der Moderator auf Schweizerdeutsch fragt. Im Fernsehen, da gehört sich eben Hochdeutsch, damit die Welschen und Tessiner auch was verstehen. Doch die gucken gar nicht zu, aber vielleicht dafür die 20% Ausländer im Land mit Hochdeutschkenntnissen.
Wenn die nur Hochdeutsch mit mir sprechen bin ich nicht integriert
Das ist der zweite Grund, warum Deutsche gern auf Schweizerdeutsch angesprochen werden. Man fühlt sich sprachlich anerkannt, der Schweizer traut einem das Hörverständnis und das Wissen über das spezielle Vokabular zu. Klasse Form der Integration. Selber sprechen dauert etwas länger, aber solange ich nicht den Mund auf mache, erkennt mich hier niemand, weil ich alles verstehe. Vogel-Strauss-Taktik sozusagen. Augen zu und Kopf in den Sand, in den Schweizersand. Und schon bin ich unsichtbar.
Kompliziert wird es im Geschäftsleben zwischen Schweizern und Deutschen
Es schrieb uns dazu eine Schweizerin:
Wenn ich nur flüchtig mit Kunden zu tun habe (die ich nicht alle fragen kann, ob sie Schweizerdeutsch verstehen): kann es als unhöflich angesehen werden, wenn ich Schweizerdeutsch spreche? Dieses Gefühl hab ich manchmal. Aber wenn ich auf Standarddeutsch antworte, scheine ich oft belächelt zu werden, im Sinne von “Och, die denkt, wir verstehen nicht…”. Andererseits denke ich, dass es wahrscheinlich einige Deutsche gibt, die lieber auf Schweizerdeutsch bedient werden, weil das andere immer ihren “anders-sein-Status” impliziert.
(Quelle: Private E-Mail)
Manchmal möchte ich mein Schweizer Gesprächspartner ermutigen: „Trainieren Sie doch einfach mit mir Ihr Hochdeutsch, ich werden dann später gern mit Schweizerdeutsches Hörverstehen mit Ihnen trainieren“… Ein Angebot zum Tandem-Lernen, jeder profitiert vom anderen. Denn eins muss ganz klar gesagt werden: Ich habe noch keinen Schweizer getroffen, der kein Hochdeutsch sprach. Für eine Verständigung hat es immer gelangt, und ich wundere mich immer, warum die meisten mit diesen Sprachtalenten so schüchtern durchs Leben laufen und das nie pflegen und ausbauen wollen. Das ist dann wieder der Moment in dem ich eine Wut bekomme auf die vermutlich schlechten Lehrer, die den Schweizern den Spass und das Interesse an ihrer zweiten Muttersprache so gründlich ausgetrieben haben mochten.
Ich wünschte, mein Italienisch, Spanisch oder besser noch „mein Schweizerdeutsch“ sei nur annähernd so gut wie das Standarddeutsch der meisten Schweizer.
Was fragt man als Schweizer am besten einen unbekannten Deutschen?
Nun, wir hätten da einen Vorschlag zur Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses zwischen Schweizern und Deutschen. Wenn Sie es offensichtlich mit einem Deutschen zu tun haben, von dem Sie nicht wissen, ob er Schweizerdeutsch versteht, dann fragen Sie doch einfach so:
„Macht es Ihnen was aus, wenn ich mit Ihnen mein Standarddeutsch trainiere, oder möchte Sie ihrerseits lieber ihr Schweizerdeutsch verbessern?“ Zu kompliziert? Vielleicht… aber ein bisschen träumen wird doch erlaubt sein.