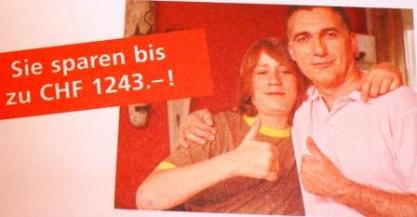Die Schweiz als Glücksfall der Geschichte — Leben wir auf der Insel der Glückseligen?
Dezember 13th, 2006Im Sommer lasen wir im Tages-Anzeiger einen höchst interessanten Artikel von Helmut Stalder:
Die Katastrophen des 19. Und 20. Jahrhunderts zogen an der Schweiz vorbei als sei sie nicht von dieser Welt. Politisch praktisch stabil seit 1848, sozial weit gehend befriedet seit dem Generalstreik 1918, verschont von zwei Weltkriegen – die Schweiz hat wenig Grund zur Klage. Warum blieben ihr die Verwerfungen der Geschichte erspart? Handelte sie besonders klug? Half jeweils der Zufall? Oder waltet ein gütiges Schicksal über dem auserwählten Volk? Die Geschichte der Schweiz, die scheinbar so bruchlos verlief, verleitet leicht zu einer verklärten Sicht.
(Quelle für alle Zitate, soweit nicht anders gezeichnet: Tages-Anzeiger vom 21.08.06)
Diese verklärte Sicht wird heute häufig angeführt. Die Schweiz versteht sich als „Sonderfall“, die Schweiz wird als „Glücksfall der Geschichte“ gedeutet.
Der Prototyp des Glücksfalls ist, dass die Schweiz im Zweiten Weltkrieg nicht angegriffen wurde. General Guisan legte das Deutungsmuster «Glücksfall» schon früh bereit, im Tagesbefehl vom 8. Mai 1945: «Nach fast sechs Jahren Krieg wurde in Europa der Befehl zur Einstellung des Feuers gegeben. (…) Die Armee hat ihre Hauptaufgabe, mit der sie im Herbst 1939 betraut wurde, erfüllt. Soldaten, wir wollen nun vor allem dem Allmächtigen danken dafür, dass unser Land von den Schrecken des Krieges verschont blieb. Eine wunderbare göttliche Fügung hat unsere Heimat unversehrt gelassen. Unsere Armee war und ist unser Schutz und Schirm.» Damit ist zweierlei gesagt: Die Schweiz überlebte unversehrt dank der Armee und dank dem Allmächtigen.
Unter Historikern wird bis heute die Frage diskutiert, warum Nazideutschland die Schweiz nicht überfallen hat. Pläne dafür gab es sehr wohl, und der viel zitierte Satz „Die Schweiz, das kleine Stachelschwein, nehmen wir auf dem Rückzug ein“, dessen genau Herkunft nicht mehr feststellbar ist, war fest im Bewusstsein der Schweizer verankert.
Unter Operation Tannenbaum fasst man eine Reihe von Angriffsplanungen zur überfallartigen Besetzung der Schweiz von Deutschland und Frankreich zusammen, die Otto Wilhelm von Menges nach dem deutsch-französischen Waffenstillstand von Compiègne am 24. Juni 1940 als Auftrag erhielt. Es war vorgesehen, dass bei der Umsetzung der Angriffsplanung die italienischen Truppen mit einem gleichzeitigen Angriff von Süden aus unterstützend wirken würden. Mit ihnen wurde um dem 31. Juli 1940 eine ungefähre Teilungslinie für die Schweiz fixiert, die von Saint Maurice über die Wasserscheide Aare-Rhône weiter zum Tödi und ins Rhätikon führte, um schließlich am Muttler zu enden.
Otto Wilhelm von Menges hatte bis 12. August 1940 die dritte aktualisierte Fassung des Operationsplanes des Generalstabes des Heeres fertiggestellt. Menges ging davon aus, dass das Schweizer Heer so zu zerschlagen sei, dass ein Ausweichen ins Hochgebirge und ein geführter Widerstand (Réduit) unmöglich werde. Dabei seien Bern, Solothurn und Zürich (Oerlikon) schnell und unversehrt zu besetzen. Dazu kam: „Gewinnung der wichtigsten Eisenbahn- und Straßenknotenpunkte sowie der zahlreichen Brücken und Tunnel in unbeschädigtem Zustande, um das Land als Durchmarschgebiet für alle Transporte nach Südfrankreich nutzbar zu machen“.
(Quelle: Wikipedia)
Eine verbreitete Theorie besagt, dass die Nazis die Schweiz als „neutralen“ Lieferanten für kriegswichtige Stoffe benötigten, also mit der Schweiz quasi legal Geschäfte machten, und darum dieses Land in Ruhe liessen, eine andere Theorie führt aus, dass rein strategisch die Schweiz nicht interessant war. Der Nachschub nach Italien funktionierte über den Brenner genauso wie über den Gotthard.
Die Gretchenfrage auch für alle Militärhistoriker ist: Hat das Modell der Miliz-Armee Schweiz gegen den Feind aus Nazideutschland tatsächlich soviel abschreckende Wirkung gezeigt, dass es als ein Erfolgsmodell bezeichnet werden darf?
Stalder schreibt:
Selbst grosse Historiker wie Edgar Bonjour prägten die Formel, die Schweiz habe «einfach Glück gehabt». Bis in die 70er- Jahre vermied es die Forschung, der Frage auf den Grund zu gehen. Nur langsam kam es zur Rationalisierung des «Glücksfalls», unter anderem durch die Historiker Jakob Tanner («Bundeshaushalt, Währung und Kriegswirtschaft», 1986) und Markus Heiniger («Dreizehn Gründe. Warum die Schweiz im Zweiten Weltkrieg nicht erobert wurde», 1989). Beide stuften den militärischen Anteil zurück und hoben die wirtschaftliche Kooperation der Schweiz mit Nazi-Deutschland hervor.
Inzwischen wurde unter anderem durch die Bergier-Kommission ein ganzes Bündel von Faktoren ausgebreitet, die zur Verschonung geführt hatten. Die Sicht der Armee als alleinige Retterin ist nicht mehr haltbar, und Gottes Beitrag verflüchtigt sich. Tanner sagt heute, dass durchaus Glück im Spiel war, aber er bürstet es gegen den Strich: «Führt man Glück als Faktor ein, so kann man das auf göttliche Vorsehung beziehen oder mit dem viel prosaischeren Sachverhalt in Verbindung bringen, dass die Schweiz strategisch im ‹toten Winkel› lag und der durchaus beabsichtigte Anschluss von der Kriegsführung der Alliierten durchkreuzt wurde – sodass die Schweiz einfach Glück hatte, weil die Alliierten den Kontinent rechtzeitig befreiten.»
Denn hätte Nazideutschland in Europa weiterhin seinen Expansionskrieg erfolgreich führen können, es hätte nicht lange gedauert, und Hitler hätte sich auch die Schweiz einverleibt. Er hat sich deutlich abfällig über die kleinen demokratischen Länder wie Dänemark, Schweden und die Schweiz geäussert.
Dennoch prägt die Idee des Glücksfalls das Selbstbild der Schweiz – meist in der Form des «Glücks der Tüchtigen»: Da ist aus dem 18. Jahrhundert die Ikonografie der Alpeninsel, wo unverdorbene Menschen tugendhaft und edel nahe am glücklichen Urzustand leben. Da ist die im 19. Jahrhundert aufgewertete Gründungsmythologie mit Tell und den Schwurbrüdern, die, wie es Schiller darstellte, als Hüter der Pässe im höheren Auftrag den Gotthardweg zum Heiligen Vater nach Rom bewahren. Und da ist in modernerer Form die Vorstellung vom «Sonderfall Schweiz», entstanden als liberale Kleinrepublik mitten im reaktionären Europa, sich tapfer behauptend gegen alle Fährnisse, unschuldig, harmlos, neutral, urdemokratisch und deshalb zu Recht vom Schicksal belohnt.
„Harmlos“ ist diesem Zusammenhang relativ. Immer war das Land hochgerüstet, lieferte Rüstungsgüter in die ganze Welt und gut trainierte Söldner aus der Schweiz waren nicht nur in Rom beim Papst beliebt. Auch „urdemokratisch“ hat einen bitteren Beigeschmack, wenn man sich die Geschichte des Frauenwahlrechts in der Schweiz und anderen Ländern Europas anschaut.
Das Unglück sind die andern
Die Kehrseite: Wer sich selbst so glücklich schätzt und das noch als eigenes Verdienst empfindet, sieht die andern als Unglückliche, unterstellt ihnen Neid und sieht, was ringsum geschieht, in erster Linie als Bedrohung. Man wähnt sich auf der Insel der Glückseligen und zieht sich von der Welt zurück. Folgerichtig hielt sich die Schweiz lange von der Uno fern. Folgerichtig beobachtet sie die EU mit Misstrauen. Europa ist aus Schmerz geboren. Das Unglück des Weltkriegs lehrte die Nationen, dass sie ihr Glück in der Kooperation suchen müssen. Die kollektive Erfahrung von Leid ist der Ursprung der EU, ein Projekt, das zuallererst der Friedenssicherung dient. Die Schweiz hat eine grundlegend andere Erfahrung: Indem sie das Glück hatte, verschont worden zu sein, wurde sie um die Leiderfahrung gebracht. Sie redet sich ein, sie sei für ihr Glück nicht auf andere angewiesen; es lasse sich vielmehr bewahren, indem man sich draussen hält. Die Frage ist nur, ob es in der heutigen Welt drinnen und draussen noch gibt.
Den Wunsch vieler Schweizer, sich von „aussen“ zu schützen, bezeichne ich gern als das „Zugbrücken-Syndrom“. Am besten sollten sie wieder eingeführt werden, die Zugbrücken, um die Festung „Schweiz“ wehrhaft von der Aussenwelt abschotten zu können (vgl. Blogwiese).
Die „fehlenden Leiderfahrung“ muss eine Schweizer Grunderfahrung sein. Sie ist vielleicht der Grund für die ausserordentlich hohe Bereitschaft in der Schweiz, das Leid andere lindern zu wollen, so zuletzt nach der Tsunami-Katastrophe in Asien.
Die Frage, ob es in der heutigen Welt ein „Drinnen und Draussen“ noch gibt, ist natürlich rein rhetorisch. Die Schweizer Banken verwalten das Geld von „Draussen“ und sind selbst „draussen“ aktiv. Die Schweizer Wirtschaft und das Bankenwesen sind „Global Player“, wie wir erst neulich mit einem Zitat über die UBS in einem Kommentar anführten:
Die UBS ist in 50 Ländern und an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt mit Niederlassungen vertreten. 39 % ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Amerika, 37 % in der Schweiz, 16 % im restlichen Europa und weitere 8 % im asiatisch-pazifischen Raum tätig
(Quelle: Wikipedia)
Sind 50 Länder genug „draussen“?