Ich lenke, also denke ich — Verwirrungen durch einen Schweizer Werbeslogan
Dezember 6th, 2006Neulich fand in Bülach, der Lifestylemetropole des Zürcher Unterlands, ein schnuckliger Weihnachtsmarkt statt. Nein, es war natürlich eher ein „Weihnachtsmärt“. Bei dieser Mischung von vorne Hoch- und hinten Schweizerdeutsch erstaunt uns immer wieder die Konsequenz, mit der eben nicht einfach jedes Wort auf Schweizerdeutsch geschrieben wird. Google-CH findet „Weihnachtsmärt“ 907 Mal , die „Wienachtsmärt“ Fundstellen sind dagegen vergleichsweise selten und mit nur 284 Exemplaren deutlich in der Minderzahl. Wahrscheinlich wegen der Verwechslungsgefahr mit den Nächten in Wien? Wer weiss.
Jedenfalls sahen wir dort auf dem Weihnachtsmarkt einen Raclette-Stand mit der deutlichen Beschriftung „Lenk dänk“ und wurden nicht schlau draus.

Leider ist mir beim Fotoschiessen im Getümmel das „k“ am Ende nicht ganz mit aufs Bild gekommen.
Wir machten uns danach auf die Suche, was dieser hübsche Spruch „Lenk dänk“ wohl zu bedeuten hat und stiessen im Internet auf zahlreiche weitere Fundstelle:
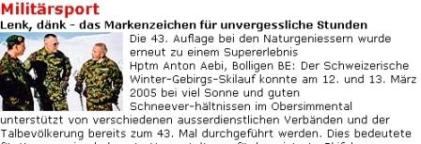
(Quelle Foto: schweizer-soldat.ch)
Aber wirklich begriffen hat wir diesen Spruch dadurch noch nicht. „Lenken“ und „denken“ gehören offenbar eng zusammen in der Schweiz, selbst beim Militär. Das Hirn des Autofahrers ist nicht weit vom Lenker entfernt, und manchmal denkt der Lenker auch selbst, wie wir in zahlreichen Unfallberichten gelesen haben, wenn ein „Lenker“ wieder einmal eine Kurve nicht gekriegt hat und ein „Bord“ herab stürzte oder in einen „Kandelaber“ fuhr.
So befragten wir einen Spezialisten des Schweizerdeutschen dazu und erfuhren, dass es da zwei Orte mit Namen „Adelboden-Lenk“ gibt, die allen Skifahrern wohl bekannt sind, und die mit einem pfiffigen Werbespruch seit vielen Jahren für sich werben:
Der Dialekt-Werbespruch „Adelbode-Länk, dänk!“ ist schon Jahrzehnte alt. Gerade wegen seiner Kürze ist er besonders einprägsam. Es bedeutet sinngemäss ganz einfach, dass man „logischerweise“ in eben diesem Skigebiet Ferien/Urlaub macht.
(Quelle: Private E-Mail)
Das allein wäre uns als Nicht-Skifahrer nie aufgefallen. Ja, es gibt noch andere Menschen, die das Los unserer Freundin „Don’t mention the skiing“ Heather teilen und nicht alle Winterspororte der Schweiz kennen. Dafür kennen wir aber die besten Rodelpisten in Castrop-Rauxel, Recklinghausen und Wanne-Eickel. Sie nicht?
Doch weiter in der Erklärung des Spezialisten:
Das Wort „dänk!“ (wörtlich: „denke!“ oder vielleicht „denk nur, denk doch!“), das besonders Kinder oft brauchen, kann man sinngemäss am besten mit „natürlich“ oder vielleicht noch mit „doch“ übersetzen. Jedenfalls bedeutet es immer etwas, das doch logisch ist/sein sollte, wie in folgenden
Beispielsätzen:
Dass dis Auto fahrt, muesch zerscht Bänzin tanke – Das wäiss ich DÄNK! (Damit dein Auto fährt, musst du erst Benzin tanken – Das weiss ich NATÜRLICH!) „Du muesch DÄNK zerscht uf de Chnopf drucke, dass de Lift chunnt, susch chasch no lang warte! – Ich han DÄNK scho drü mal druckt!“ (Du musst DOCH erst den Knopf drücken, damit der Aufzug kommt, sonst kannst du noch lange warten! – Ich hab DOCH schon dreimal
gedrückt!)Die Zürcher Aussprache ist eher „tänk!“, aber die Lenk befindet sich im Berner Simmental, Adelboden liegt im Berner Oberland, das wissen alle, die das Lied „Vogellisi“ kennen. Deshalb Berndeutsch: „dänk“.
Die Zürcher haben dafür die Idee des „Think tank“ für sich in Beschlag genommen, eine „Denkfabrik“, die im Prinzip eher Schweizerdeutsch als „Dänk tank“ bezeichnet werden sollte. Die drei Schweizer Denkfabriken „Avenir Suisse“, das Gottlieb Duttweiler Institut und das Liberale Institut befinden sich im Kanton Zürich, aber soll ja nichts heissen. Wer viel schnurrt muss eben auch mal nachdenken.
Wenn du die genervte Aussage „Das wäiss ich dänk!“ (Das weiss ich doch!) hören willst, dann gib mal mundartsprechenden Kindern in deiner Nachbarschaft einen Tipp, der sie als komplett intellektuell unterentwickelt darstellt. (z.B. „Weisst du, Wenn du dir die Augen zuhältst, kann ich dich trotzdem sehen.“)
Man trifft diesen Ausdruck seltener ausserdem an, wenn man seine Meinung gepaart mit möglichen Zweifeln ausdrücken will im Sinn von „wohl“. Wie etwa hier: „Warum poschtet de Häiri gäng nur Büchsene und Fertigmönü? – Er chann DÄNK nöd choche.“ (Weshalb kauft Heinrich immer nur Dosen und Fertiggerichte ein?
– Er kann wohl nicht kochen.)
Wir werden uns die Floskel „DÄNK“ sogleich einverleiben und gelegentlich in unseren Redefluss einfliessen lassen, vielleicht links und rechts garniert von einem hübschen „IM FALL“ und einem „LÄCK“. Letzteres kenne wir ja schon von den Schleckstangen.
Runden wir unsere Erkenntnisse ab mit dem Plan, die nächsten Wanderferien in Adelboden-Lenk zu verbringen, vielleicht im Februar? Denn Schnee fällt ja offensichtlich in den nächsten Monaten keiner mehr.
Zum Schluss darum nochmal das Fazit unseres Spezialistenfreundes:
Und wenn du nun noch immer nicht weisst, Wo man seine Ferien zu verbringen hat, schreit es dir die Werbung als natürliche Antwort, die ja jedes Kind wissen sollte, von den Wänden: „I der Länk, dänk!“ (In der Lenk, natürlich!)
P.S.: Nein, für diesen Beitrag habe ich leider keinen dreiwöchigen Aufenthalt in einem Wellnesshotel in Lenk inklusive Skikurs gesponsert bekommen, snief.


