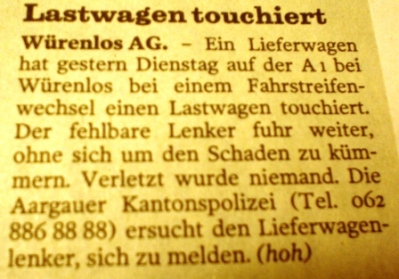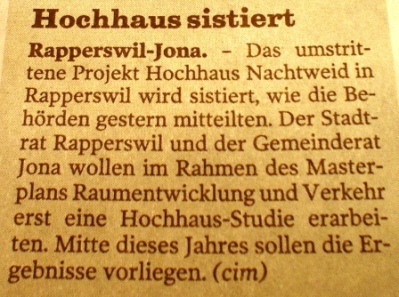Der Weibel weibelt — Wenn nicht die Weiber sondern die Werbung gemeint ist
Januar 29th, 2006Seit wir in der Schweiz wohnen, konnten wir fast täglich unseren kümmerlichen hochdeutschen Wortschatz um interessante Wörter der Deutschen Sprache erweitern. Dabei hilft uns die aufmerksame Lektüre des Tages-Anzeigers, aber auch in amtlichen Mitteilungen finden sich mit unter interessante Berufe und Tätigkeiten. So stiessen wir auf den
Das klingt zwar ähnlich wie „Weiber“, hat aber nur sehr entfernt mit diesen etwas zu tun. Das Wort „Weiber“ stammt vom „wip“, „wif“ „Wîb“, dem „Weib“ ab, dessen Ursprünge nicht ganz geklärt sind. Dahinter könnte die „umhüllte Braut“ genauso stecken wie die „umherwirbelnde Hausfrau“. Es hat was mit Bewegung und umhergehen zu tun, gemäss Herkunftswörterbuch des Dudens.
Auch der Schweizer „Weibel“ geht umher, denn er hat Nachrichten zu überbringen:
Wei|bel, der; -s, :
(schweiz.) untergeordneter Angestellter in einem Amt, bei Gericht. Amtsbote.
(Quelle: Duden)
Uns bleibt in Deutschland nur eine Variante des Weibels, der „Feldwe(i)bel“, der auf dem Feld herumwiebelt oder -wirbel. Auch das Verb „wiebeln“ wird im Duden erwähnt:
wie|beln
(landsch.): sich lebhaft bewegen
(Quelle: Duden)
Doch zurück zum „Weibel“: Dieses Amt wird nicht nur für die Überbringung von Nachrichten benötigt. Auch bei Gemeindeversammlungen hat der Weibel zu tun:
Ein Mann wird von einem Weibel durch den Gemeindesaal geführt, vorbei an hundert Regensdorfer BürgerInnen, die an diesem Abend über die vorliegenden Einbürgerungsgesuche abzustimmen haben. Der Weibel führt den Mann zum Mikrofon, das zwischen den Versammelten und der Tribüne aufgestellt ist.
Quelle:
Passend zum „Weibel“ gehört noch das Verb „weibeln“, das laut unserem Duden bedeutet:
weibeln (schweiz. für werbend umhergehen)
ich weible, du weiblest, er weiblet
Da kann es schon mal passieren, dass wir uns verhaspeln, und ein „e“ zuviel aussprechen: „Ich weible“ oder „ich weibele“, doch wir wissen ja von den Zür(i)chern, wie wichtig das ist, diese zusätzlichen Vokale auf keinen Fall auszusprechen, um sich nicht als deutscher Ignorant zu outen.
Das Verb „weibeln“ ist in der Schweiz häufig in Gebrauch, Google-Schweiz nennt 604 Fundorte
Beispiele:
Die SP ihrerseits, die sonst nicht genug für Einsätze der Schweiz zur Friedensförderung weibeln kann, hätte es in der Hand gehabt, hier ein Zeichen im Sinne ihrer Politik der Öffnung zu setzen;
(Quelle:)
Der neue Finanzausgleich schafft die Voraussetzung, um die Verkehrsprobleme in den Agglomerationen anzupacken. Deshalb weibeln Verkehrspolitiker für die Vorlage
(Quelle Tages-Anzeiger)
Bis zur Parolenfassung Ende April «darf ich auch als Kantonalpräsident intern gegen Schengen weibeln. (Quelle Tages-Anzeiger)
Echte Weibel sind auch zünftig angezogen. Dann nennen sie sich „Zunftweibel„:
(Quelle: Zunft zu Safran)
In der Schweiz gibt es praktisch auf jeder politische Ebene eigene Weibel:
Standesweibel (auch Staats- oder Landesweibel) sind entweder für die Regierung oder das Parlament ihrer Kantone, jedoch meistens für beide, tätig.
Die Gerichtsweibel der Kantone gehören der Vereinigung nicht an.
Bundesweibel sind im Dienste aller drei Gewalten des Bundes tätig:
Bundesratsweibel sind einem Bundesrat fest zugeteilt.
Parlamentsweibel sind entweder dem National- oder dem Ständerat zugeteilt.
Bundesgerichtsweibel sind für das Bundesgericht in Lausanne oder für das Eidg. Versicherungsgericht in Luzern tätig.
(Quelle:)
Hier sehen wir Weibel kurz vor bevor sie weibeln:

Bereit zum Weibeln in Luzern
(Quelle: Gnuesser.ch)