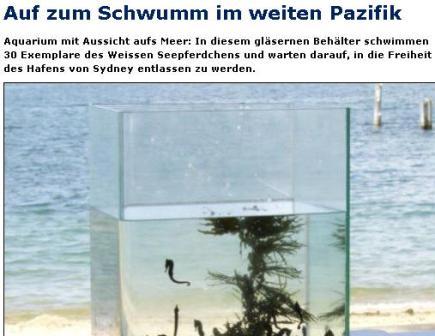Haben Sie auch einen zu kleinen Rucksack?
November 16th, 2007(reload vom 17.11.05)
Ein kleiner Rucksack ist eigentlich eine ganz feine und angenehme Sache in den Bergen. Die Dinge für einen Tag passen hinein, darum heisst er auch auf Neudeutsch „Day-Pack„. Wenn Sie in der Schweiz eine Berufsausbildung beginnen wollen, sollten Sie sich aber lieber ein etwas grösseres Modell zulegen, so einen 30 – 40 Liter Rucksack vielleicht, mit integriertem Traggestell. Denn Sie brauchen einen grossen Rucksack offensichtlich für die Berufsausbildung, und er kann nicht gross genug sein, doch lesen Sie einfach selbst:
Schüler für die Lehre fit machen
Eignungstest in einer Grossbank: Die Firmen misstrauen den Schulnoten.
Warum finden Junge keine Lehrstelle? Weil das Angebot knapp ist. Aber nicht nur: Viele genügen den Anforderungen der Wirtschaft nicht. Jetzt reagieren die Sekundarschulen.
Von Antonio Cortesi
Alle jammern. Die Politiker, weil die Wirtschaft zu wenig Lehrstellen anbietet, und die Schulabgänger, weil sie Dutzende von Bewerbungen schreiben müssen (…). Aber auch die Firmen klagen. Sie bemängeln, allzu viele Schülerinnen und Schüler brächten einen zu kleinen Rucksack für eine Lehre in ihrem Betrieb mit.
Die Firmen beklagen sich nicht ohne Grund, wie eine kürzlich publizierte Nationalfondsstudie zeigt. Der Zürcher Bildungsforscher Urs Moser hat bei den acht Schweizer Grossunternehmen ABB, Migros, Novartis, SBB, Siemens, SR Technics, Swisscom und UBS die Ergebnisse von 1420 Eignungstests und Assessments untersucht. Parallel dazu testete Moser die Jugendlichen selber gemäss den Vorgaben der Pisastudie auf ihre Mathematikkenntnisse und ihre Lesekompetenz.
Die Resultate sind in hohem Mass Besorgnis erregend:
Nach dem 9. Schuljahr genügen einzig die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten den Anforderungen für eine anspruchsvolle Lehre (Kaufmann oder Informatik). Jeder zweite Schüler der Sekundarschule bringt einen zu kleinen Rucksack für eine KV- oder Informatik-Lehre mit.
(Quelle: Tages-Anzeiger vom 01.02.05)
Also was lernen wir daraus: Als engagierter Lehrer sollten wir unbedingt noch ein Outdoor-Ausrüster Geschäft in unserer Freizeit aufziehen, um den jungen Leuten mit passendem Equipment ausstatten zu können. So ein schickes Modell von Salewa oder Wolfskin kann dann richtig Karriere fördern wirken.
Und gross soll er sein, der Rucksack, denn so eine Berufsausbildung, die dauert lange und da muss wohl ne Menge Proviant reinpassen, und ein warmer Schlafsack, wenn einem der kühle Wind des Alltags um die Nase pustet im Geschäftsleben.