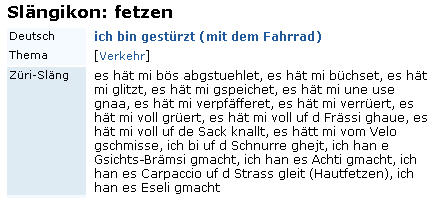Zürich ist auch Ausland
Uns erreichte per Mail ein neuer Kommentar zu einem alten Beitrag auf dem „Jobblog“ zum Spiegel-Artikel „Deutsche in der Schweiz — Heim ins Reich“ vom 4.01.07. Er stammt von einem Deutschen namens Sebastian Bachman. Sebastian hat ziemlich miese Erfahrungen in Zürich gemacht, denn er schreibt:
Ich komme aus Hannover und mache gerade mein Auslandssemester an der Uni Zürich. Somit ist auch mein Aufenthalt in der Schweiz bis zum Ende des Semesters beschränkt…und das ist auch gut so! Ich will nicht meckern oder jmd. beschuldigen, aber das was im manager-magazin und übrigens auch im focus, SPIEGEL, Stern usw. steht, stimmt mit wenigen Ausnahmen.
(Quelle für alle Zitate des Kommentars: Jobblog-Kommentar)
Muss stimmen, denn es handelt sich hier jeweils um den gleichen Agence Press Artikel von Anna Imfeld, der am 4.1.07 auf Spiegel-Online erschien und danach fleissig von anderen Magazinen und Online-Portalen übernommen wurde.
Ich bin mit 9 Jahren nach Deutschland gekommen und habe seit meinem 15. Lebensjahr die deutsche Staatsbürgerschaft. Man könnte sagen, ich fühle mich als Deutscher. Ich habe dort Grundschule, Gymnasium und Universität besucht und habe mich noch NIE so isoliert und als Fremder oder “Ausländer” gefühlt, wie in den letzten 2 Monaten in der Schweiz.
Sebastian verrät uns nicht, woher er ursprünglich stammt. Ist es nicht das Wesentliche eines Auslandssemesters, dass man dazu ins Ausland geht, so wie er nach Zürich? Wenn man sich dann nicht wie im Ausland fühlen würde, könnte man ja auch daheim bleiben, oder?
Mal von der Presse und den Berichten über die angefeindete NRG- Zürich- Radiomoderatorin, die übrigens nach Drohungen, zerstörtem Auto und Nervenzusammenbruch in Deutschland lebt abgesehen, habe ich auch eigene Erfahrungen mit der Schweiz und den Schweizern gemacht.
„NRG“ ist eine coole Abkürzung für „energy“, muss ich mir merken. Mein erster Leseversuch ging mehr in Richtung „Nord-Rhein-Gelsenkirchen“.
Frust bei Fust
Sebastian macht negative Erfahrungen im Schweizer Einzelhandel:
In Geschäften weigern sich die Bedienungen und Berater regelrecht Hochdeutsch zu sprechen. Auch wenn man gar nicht bittet, dass sie Hochdeutsch sprechen, sondern nur etwas langsamer, wird im selben Tempo fortgesetzt. Mein Erlebnis mit einem Verkäufer: ich fragte ob man für das Gerät, das ich kaufen wollte, auch einen Adapter für Deutschland und EU verwenden kann. Der Verkäufer sagte, dass ich mir gefälligst das Gerät in Deutschland kaufen sollte, wenn es mir hier vor Ort nicht gefällt. Ich verliess den Laden (Fust) mit offenem Mund.
Wow! Immerhin hat Sebastian verstanden, was der freundliche Verkäufer ihm da sagen wollte. Unsere persönlichen Erfahrungen mit Verkäufern bei FUST, InterDiscount oder MediaMarkt in der Schweiz sind ganz anders. Es wurde stets extrem und ausschliesslich auf Hochdeutsch mit uns gesprochen, manche Berater versuchten geradezu unter Beweis zu stellen, wie gut sie es können und fragte niemals die sonst übliche Floskel „Verstehen Sie Schweizerdeutsch?“. Schliesslich traten wir als Kunde auf, dem man etwas verkaufen möchte.
Verstehen Sie Hochdeutsch?
Wie sollte man als Deutscher mit einem Schweizer Verkäufer umgehen, den man nicht versteht oder der auch nicht langsamer, geschweige denn in der Standardsprache mit einem sprechen möchte? Hierzu drei Varianten:
1.) Stellen Sie mitten im Gespräch höflich aber bestimmt die Frage: „Verstehen Sie eigentlich Hochdeutsch, oder soll ich auf Berndeutsch weiterreden?“ Ja ich weiss, die Pointe ist alt, aber verfehlt selten ihre Wirkung
2.) Wiederholen Sie langsam den letzten Satz, den der Verkäufer zu ihnen auf Schweizerdeutsch gesagt hat, möglichst wortgetreu und so wie SIE ihn verstanden haben. Zeigen Sie damit ihren guten Willen und wie eisern sie an ihrem Hörverständnis arbeiten. Manche Menschen merken dann mit unter, dass wir sie doch nicht so genau verstanden haben, wenn man ihnen so einen akustischen Spiegel vorhält. Sie können diese Technik ergänzen mit der Bitte: „Könnten Sie bitte lauter sprechen, damit ich sie besser verstehen kann?“
3.) Sagen Sie einfach „Schade, ich bin eigentlich gekommen, um hier mein Geld auszugeben. Das ich dazu erst einen Sprachkurs brauche, wusste ich nicht, tut mir leid“. Dann verlassen Sie enttäuscht dreinblickend das Geschäft.
Sebastian resümiert:
Versucht man mit den Schweizern in Kontakt zu treten, bleibt das meistens erfolglos. Ich muss betonen, dass ich von keinem in irgendeiner Weise schlecht behandelt worden bin, aber ich bin nun mal isoliert. Der Sinn meines Kommentars ist es nicht zu meckern oder zu kritisieren. Es ist so wie es ist. Wenn aber verschiedene deutsche Zeitungen über solche Vorfälle berichten, dann kann man das nicht als “unwahr” bezeichnen. Für die Deutschen gehört ein gewisses Niveau an Ausgrenzung und manchmal auch Anfeindung in der Schweiz zum Alltag.
Wir wollen doch fürs Protokoll festhalten, dass es immer die gleichen Artikel sind, die nur von verschiedenen Zeitungen neu abgedruckt wurden, und dass 190 000 Deutsche in der Schweiz dennoch freiwillig hier bleiben, sich wohl fühlen und sogar manchmal schon nach 6 Jahren ein paar Wohnzimmer von Innen gesehen haben!
Geht es der Wirtschaft gut, wird der Service schlecht
Was Sebastian dort Erstaunliches in einer Fust-Filiale erlebte, soll typisch sein für ein Land, in dem die Wirtschaft auf Hochtouren läuft. Je niedriger die Arbeitslosigkeit in einem Land und je grösser die Geldmenge, die von den Verbrauchern ausgegeben werden kann, desto stärker sinkt das „Service-Niveau“, sagen Wirtschaftsfachleute. Wenn eine Fust-Filiale gezwungen ist, solch einen unhöflichen und inkompetenten Verkäufer anzustellen, dann doch nur, weil momentan keine besser ausgebildeteren Kräfte zu bekommen sind, oder weil ein „freundliches sich Bemühen“ um den Kunden nicht notwendig ist. Der Umsatz kommt auch so rein. Das ändert sich erst, wenn der wirtschaftliche Druck wieder zunimmt und das Geld nicht mehr so locker sitzt.

(Foto: Fussgängerzone in Liverpool)
Jeanskauf in Liverpool
Im letzten Sommer war ich in „Boomtown“ Liverpool, das 2008 die Kulturhauptstadt Europas wird. Es hat sich nach einer langen Talfahrt wieder prächtig entwickelt und momentan nur noch um die 5% Arbeitslose, weil es dort wirtschaftlich mächtig brummt, wie in ganz Grossbritannien. Ich wollte dort an einem Montagmorgen um 9:00 Uhr eine Jeans kaufen. Die Managerin eines grossen Modegeschäfts sagte mir, als ich mein Anliegen vortrug: „Oh, das passt jetzt gerade nicht. Könnten Sie vielleicht in einer halben Stunde wiederkommen?“. Da kriegt ich den Mund auch nicht wieder zu, ganz wie Sebastian. Wenn man als Kunde stört, dann sollte man besser den Laden verlassen.