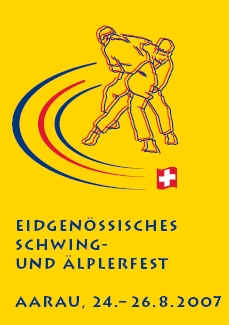(reload vom 20.10.05)
Man gönnt sich was
Der Schweizer sagt nicht „Wir gehen essen„, sondern „mir gönnt go esse„, womit er ausdrücken will: Er „gönnt“ sich was, er lässt richtig was springen. Was er allerdings unter „Go“ versteht, war uns lange Zeit unklar. Ist es eine chinesische Spezialität, die man da zu sich nimmt, so wie „Nasi GO Reng“ oder „GO Bang“ (nicht sehr lecker, weil ein Brettspiel)? Wird hier „im Gehen“ gegessen, weil die Schweizer stets rastlos sind und in der 42-Stunden-Woche keine Zeit fürs Absitzen beim Essen haben? „Absitzen“ tut man in Deutschland übrigens nur auf Befehl des Rittmeisters nach einem langen Ausritt zu Pferde, die Schweizer tun das bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wenn nur ein Stuhl in Sicht ist.
Sie gehen nur einmal essen
In der Schweiz geht man nicht „nur einmal“ essen, sondern die Schweizer lieben eine andere Formulierung: „Für einmal sind wir essen gegangen“. Sie machen alles „für einmal„, jeder dritte Zeitungsartikel beginnt mit dieser Floskel. Wir fragen uns dann stets, wie es all die anderen Male abgeht. „Für einmal ist es so „. Wir finden sie hübsch, und für einmal verwenden wir sie auch.
Die Deutschen hingegen bestellen oder kaufen alles „einmal“, so im Bus die Fahrkarte: „Einmal nach Blankenese bitte„, auch wenn nur ein Fahrgast zugestiegen ist, oder an der Pommes Bude „Einmal Pommes rot-weiss bitte!„, auch wenn der Deutsche da ganz allein steht. Aber könnte ja sein, der Verkäufer denkt, Vati wurde von der Familie zum Pommeskaufen abkommandiert und könnte sein, er möchte „vier mal Pommes rot-weiss“. Will er aber nicht, drum sagt er auch „einmal“.
Teure Pizza, sauteurer Chinese
Wenn Sie es in Deutschland gewohnt waren, beim Italiener um die Ecke mit max. 18 Fr = 12 EUR satt zu werden, incl. Getränk, legen Sie bitte in der Schweiz für die gleiche Pizza einfach mal das Doppelte auf den Tisch. Die Schweiz ist ein Hochpreisland, und besonders gut haben diese „hohen Preise“ die chinesischen Restaurants verstanden.
Schale Reis, Schale Tee und „Flühlingslolle“ kosten extra
Die Chinarestaurants in der Zürcher Agglomeration sind auch an Sonntagen geöffnet, anders als die meisten Schweizer Lokalitäten, die haben am Sonntag nämlich geschlossen. Also genau dann, wenn normale Deutsche überhaupt erst auf die Idee kommen, dass sie keine Lust zum Kochen haben und die ganze Familie zum Essen ausführen möchten.
China-Restaurants sind teuer, extrem teuer. In Deutschland ist „zum Chinesen gehen“ eine billige Ausgehalternative. Für nicht mal 25 Franken gibt es lecker Menü mit „Flühlingslolle“ und „schüss-saulen“ Schweinefleisch, sowie Jasmin-Tee und Litschies aus der Dose zum Nachtisch. Ich persönlich bestell mir immer am liebsten den grossen gemischten Salat und die Käseplatte beim Chinesen. Einfach sensationell, wie die dann gucken. Dann kommt die Rechnung, und dann gucke ich: Die Schale Reis wird mit 7 Fr. extra berechnet, der Jasmintee ebenfalls. Am Ende sind für ein simples Menü für zwei Personen leicht 100 Fr. zu bezahlen. Ob die das Geflügel für diese Suppe vorher selbst im Garten gezüchtet haben? Ähnlich wie diese sauteuren Karpfen in Japan? Wir finden keine Erklärung für diese Preise.
Am Sonntag ins Nachbarland flüchten
Und was tun die Schweizer, wenn sie in der Agglomeration von Zürich wohnen und am Sonntag Hunger haben? Wenn die Schweizer Lokalitäten geschlossen sind, weil keine Handelsreisenden und Handwerker zu erwarten sind, und die Küche frei hat? Sie fahren über die Grenze nach Deutschland oder ins Elsass, um sich richtig tüchtig satt zu essen.
Die Ausflugslokalitäten im Südschwarzwald sind Sonntags immer geöffnet, oft gibt es gar keine Speisekarte sondern nur ein Menü, denn am Sonntag wird die deutsche Mutti vom deutschen Vati verwöhnt: Bei jeder sich bietenden Gelegenheit (Geburtstag, Taufe, Konfirmation, Hochzeitstag, Beerdigung… habe ich was vergessen? Ja, den Muttertag!) gehen die Deutschen aus und essen Menü. Ohne Reservierung läuft da meistens gar nix. Bezahlbar ist es auch.
Wenn die Saaltochter „einziehen“ will
Wir wohnten schon 3 Jahre in Bülach, und wir hatten immer noch nicht die örtliche Kneipenlandschaft näher untersucht, also in Sachen Wirtschaftswissenschaft einen Zug durch die Gemeinde gemacht. Bülach ist eine Schlafstadt, die relative geringe Anzahl von Kneipen bei Tausenden von Einwohnern lässt uns Schlimmes ahnen (Zum Vergleich: Es gibt in Norddeutschland Dörfer, die bringen es auf zwei Wohnhäuser und drei Kneipen, kein Witz!). Die Bewohner Bülachs haben wohl kein Verlangen nach einem frisch gezapften Pils am Abend . Verständlich, denn Schweizer Bier ist schon nach 30 Sekunden „parat“, wo bleiben da die vergnüglichen 6 Minuten Wartezeit auf ein frisches Pils?
Wir starten eine Testtour, und landen in einer umgebauten Schickimicki Bahnhofskneipe mit dem passenden Namen „Quo Vadis“.

Das ist Latein und bedeutet: „Wohin gehst Du“ (in meinem Heimatdialekt kurz „Wo gehse?„). Klasse Namen für eine Bahnhofskneipe. Die „Saaltochter“ bringt uns die Biere und möchten dann „einziehen“. Wir rätseln, ob sie
a.) bei uns nun ins Arbeitszimmer einziehen möchte, oder ob sie
b.) den Kopf einziehen muss zur Vermeidung eines Zusammenstosses, oder ob wir
c.) vielleicht eine Einzugsermächtigung unterschreiben sollen,
denn offensichtlich geht es um Geld.
Nein, sie will schlichtweg kassieren. Na, warum sagt sie das dann nicht? So direkt darf das hier nicht ausgedrückt werden. Die Schweizer sind da etwas diskreter, lernen wir daraus.