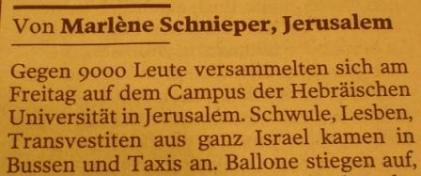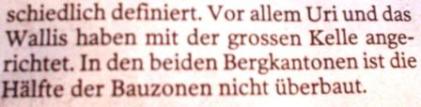Gute Büezer müssen nicht büssen — Von Malochern, Bosselern und andern Menschen
Februar 24th, 2010(reload vom 12.12.06)
Wir lasen im Tages-Anzeiger vom 25.11.06 auf Seite 5:
„Bis Ende der 80er-Jahre wusste in der Schweiz kaum jemand, dass es Kosovo-Albanien gibt“, sagt Ueli Leuenberger, grüner Nationalrat aus Genf und Migrationsfachmann. Die Albaner galten als gute Büezer, waren ruhig und machten keine Probleme.
Moment bitte, für was mussten sie dann eigentlich büssen? Oder haben wir hier erneut einen bedeutungsunterscheidenden Diphthong übersehen. Hat Büezer mit Büsser gar nichts zu tun?
Der „Büezer“ findet sich bei Google-Schweiz 24.000 Mal. Er findet sich in der NZZ:
Das Komitee, das sich als Anwalt der einfachen Büezer versteht,
(Quelle NZZ 9.7.05)
genauso wie im Tages-Anzeiger:
Ihre Initiative ist sicher toll. Aber was konkret bringt mir kleinem Büezer diese Initiative?
(Quelle: Tages-Anzeiger vom 21.11.06)
Unser Variantenwörterbuch kennt neben dem Büezer natürlich auch die Büezerin:
Büezer, Büezerin CH, der: -s, -bzw, die; – , -nen (Grenzfall des Standards): HACKLER A-ost, MALOCHER D-mittelwest „Arbeiter(in)“: Unfrohe Kunde kurz vor Weihnachten für 700 Büezer in Pratteln. Ihre Fabrik soll anscheinend geschlossen werden (Blick 12.11.99,1)
Die „Büez“ wird auch als „der Krampf“ (oder „Chrampf“, zur Unterscheidung vom Waden-Krampf) bezeichnet, während in D-mittelwest „Maloche“ für anstrengende Arbeit oder Schufterei gebräuchlich ist. Das Schweizer Wörterbuch von Kurt Meyer kennzeichnet „Büez“ interessanter Weise als „mundartl., salopp“ und bringt die Schreibweise mit „t“ in einem Zitat aus der Nationalen-Zeitung vom 5./6.10.68:
So nebenbei hatte das Personal der Waldenburgerbahn in siebenjähriger Büetz [!] von Grund auf einen Wagen gebastelt“.
Das eingefügte Ausrufezeichen soll andeuten, dass auch Kurt Meyer geschockt war über diese Schreibweise. Aber bitte schön, die richtige Verschriftung eines Schweizerdeutschen Wortes ist doch immer noch die Sache des Schreibers! Er entscheidet, ob mit oder ohne „t„, ob mit einem oder zwei „ü„, ob mit oder ohne „e“ hinter dem Umlaut. Wer will sich denn da gleich echauffieren! Das müssen wir ganz entspannt und gelassen sehen, solange es kein Deutscher ist, der dort versucht „Büez“ zu schreiben…
Der bekannte schwäbische Herrenmodenhersteller Hugo Boss, mit Sitz in Metzingen, hat sich diesen Namen nicht ausgesucht, weil er gern auch im anglo-amerikanischen Markt seine Anzüge mit „Chef-Image“ verkaufen wollte. Nein, das „Boss“ in seinem Namen stammt vom schwäbischen Wort „Bosseler“ = Arbeiter. Bosseln ist im Schwäbischen eine Variante für „arbeiten, handwerken“ und hat nichts mit einem „big boss“ zu tun.
Grimms Wörterbuch sagt dazu:
uf den ganzen menschen, so von leib und seel, von gar zwo widerwertigen naturn ist zusamen gbosselt. FRANK spr. 2, 121b; sonntags nach dem gottesdienst, ja da posselt man so was kleines für sich selbst zurecht. FR. MÜLLER 3, 113; doch was soll dichtung, scene, idylle? musz es denn immer gebosselt sein, wenn wir theil an einer naturerscheinung nehmen sollen? GÖTHE 16, 21; der held deiner posttage, sagt er, ist ein wenig nach dir selber gebosselt. J. P. Hesp. 4, 166; die theatermaske, die ich in meinen werken vorhabe, ist nicht die maske der griechischen komödianten, die nach dem gesicht des gespotteten individuums gebosselt. war. Tit. 1, 72. diese bedeutung mahnt auch an bosse, entwurf, larve, bossieren. SCHM. 1, 298 hat posseln, posteln, pöseln, pöscheln, kleine arbeiten verrichten. posteln (vgl. nachher bosten, bosteln) erinnert an basteln
(Quelle: Grimms Wörterbuch)
Ganz entfernt findet sich also ein Spur von „bosseln“ noch in „basteln“, wie es nun zur Weihnachtszeit so beliebt ist und immer in gleich in Arbeit ausartet. „Bosser“ ist in Frankreich auch ein Wort für „arbeiten„, ob es vielleicht von Napoleons Truppen im Schwabenland zurückgelassen wurde?
So bosseln die Bosseler und chrampfen die Büezer und malochen die Malocher, und jeder auf seine Art. Ist es nicht wundervoll, wie viele Wörter es für anstrengende Tätigkeiten gibt?
Das Züri-Slängikon verzeichnet 28 Begriffe für „arbeiten“:
aaschaffe, ackere, ad Seck gah, Batzeli verdiene, bügle, chnuppere, chnüttle, chrampfe, chrämpferle, chrüpple, d Stämpel-Uhr beschäftige, Freiziit vergüüde, grüble, hacke, i d Hose stiige, in Bou gah, in Bunker gah, in Stolle gah, maloche, noddere, pickle, Raboti mache (Anlehnung ans Russische), rackere, robottere, rüttle, s Bättle versuume (zu wenig verdienen), schufte, tängle, wörke (von engl. to work)
(Quelle: Slängikon)
Sogar die Malocher aus dem Kohlenpott haben es sprachlich bis nach Zürich geschafft! Na dann: „Glück auf“.