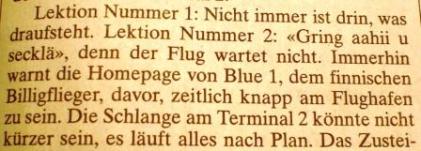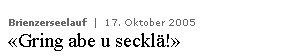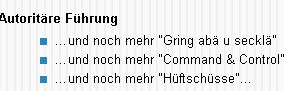Lassen Sie Haare oder Fäden? — Von guten Fäden, Bürzis, Mäusen, Stutz und Klötzen
Mai 19th, 2010(reload vom 30.01.07)
Vor einiger Zeit berichteten wir über das Adjektiv „langfädig – Faden“ gleichbedeutend mit „Haar“, so wie man hierzulande statt „sich kämmen“ zur Strahlenpistole greift um sich zu „strählen“?
Die Haare der Schweizer werden sowieso sprachlich anders behandelt als in Deutschland. Ein gemeiner „Haarknoten“ oder „Dutt“, im Schwabenland und bei modebewusste Schweizern auch „Chignon“ genannt, ist in der Schweiz ein „Bürzi“ oder „Pürzi“. So fanden wir im Variantenwörterbuch den Beleg:
Ein paar weisse Fäden durchziehen ihr pechschwarzes Haar, dass im Nacken zu einem Bürzi geknotet ist.
(aus Susan Wyss: „Helle Tage Dunkel Tage“, Zürich, Ringier 1995)
In diesem Zitat aus einem Schweizer Roman haben wir beides: Das Bürzi und die „weissen Fäden“ mitten im Haar.

(Quelle Foto: flash-coiffure.ch)
Wer sonst noch keinen guten Faden lässt:
Keinen guten Faden lassen die Bürgerlichen an den Beschäftigungsprojekten für Sozialhilfebezügerinnen und –bezüger. Sie seien zu teuer, zu phantasielos, von der GGZ zu wenig gut überwacht etc.
(Quelle: GrünGründlichRot.ch)
oder hier:
Und jetzt diese Umfrage. Besteht da nicht die Gefahr, dass sich vor allem jene melden, die am Vertragswerk keinen guten Faden lassen?
(Quelle: Schweizerische Eisenbahn- und Verkehrspersonal-Verband )
Bei Google-DE liessen sich lediglich Verweise auf Sprichwortsammlungen und Wörterbücher finden. Eine ältere Deutsche sagte mir, dass sie diese Redewendung zwar kennt, aber als „veraltet“ nicht mehr aktiv gebraucht. Da beisst die Maus keinen Faden ab. Auch wenn sie „mausarm“ ist. Übrigens ist auch dies ein echter Helvetismus. Gemeindeutsch wäre dafür „arm wie eine Kirchenmaus“.
Warum ausgerechnet Mäuse arm sein sollen, wenn doch der Begriff „Mäuse“ selbst ein Synonym für Geld ist bei den Deutschen. Neben den Mäusen finden sich in Deutschland auch die „Kröten“, „Möpse“, „Flöhe“ oder „Mücken“ als Wort für das Geld. Den Schweizern reicht ein lebloser „Stutz“ hingegen aus, selten mal als „Klotz“ oder etwas „Kohle“ umschrieben.
Ein Klotz ist in Deutschland etwas das behindert, wenn es am Bein hängt und beim Marschieren stört. Der Vers eines Marschlieds geht so: „Klotz. Klotz. Klotz am Bein, Klavier vorm Bauch, wie lang ist die Chaussee? Links ne Pappel, rechts ne Pappel, in der Mitte Pferdeappel, immer noch Chaussee“.
Im Variantenwörterbuch fanden wir ein Zitat aus der Zeitschrift CASH:
„Die Nationalbank, der AHV-Fonds, die Suva — Sie mal nachzählen, wie viele Klotz da sinnlos herumliegen“.
(Quelle: Cash 7.5.1999, zitiert nach Variantenwörterbuch S. 416)
Ist jetzt der Plural von „Klotz“ die „Klötze„, wie das in unserem Wörterbuch steht? Oder sagt man nur beim Thema Geld in der Schweiz „viele Klotz„, als eine Art geschriebene Dialektform ohne Umlaut? Wir müssen die Frage unbeantwortet lassen und warten auf versierte Kommentare von erfahrenen Klotz-Besitzern.