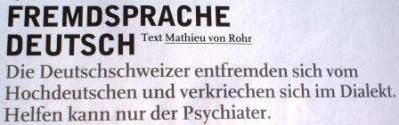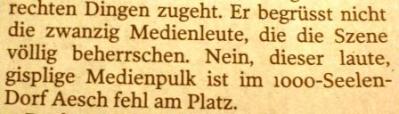Unter der Überschrift „Fremdsprache Deutsch“ schreibt der Schweizer Journalist Mathieu von Rohr in der Zeitschrift „Das Magazin“ Ausgabe 06-2006 auf Seite 14:
„Die Deutschschweizer entfremden sich vom Hochdeutschen und verkriechen sich im Dialekt. Helfen kann nur der Psychiater“.
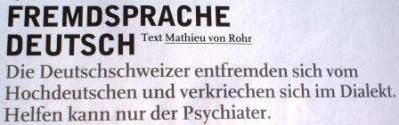
Wenn man Deutschschweizer Kinder beobachtet, wie sie durchs Wohnzimmer rennen und das geschliffene Hochdeutsch der Fernsehserien nachahmen, kann man sich nur schwer vorstellen, dass sie einst ein hochproblematisches Verhältnis zu dieser Sprache entwickeln werden. Aber der Weg ist ihnen vorgezeichnet, es gibt kein Entrinnen: Eines Tages werden sie zur Schule gehen müssen, und dort werden Lehrer auf sie warten, die selber Mühe haben mit dem Hochdeutschen, und die in die Mundart wechseln, wann immer möglich.
(Quelle aller Zitate: Das Magazin 06-2006)
Noch ein Bruder im Geiste! Wie oft haben wir das in 5 Jahren in der Schweiz als Deutsche beobachtet: Je jünger die Kinder, desto unbefangener haben sie automatisch auf Hochdeutsch mit uns gesprochen, so wie sie es aus der „Sendung mit der Maus“ oder von Peter Lustigs „Löwenzahn“ her kannten. Und wie oft haben wir selbst bei ausgebildeten Lehrern vermisst, dass sie mit uns Deutschen in der Sprache kommunizierten, die sie laut Anweisung der Eidgenössischen Erziehungsdirektion von Jahr zu Jahr früher im Primarschulunterricht verwenden sollten. Schriftdeutsch im Unterricht wurde stets von oben diktiert, aber konsequent dran gehalten haben sich wenige. Warum auch, Hochdeutsch mit den Kindern zu sprechen, das sei ein „Rohrkrepierer“, sagte ein Primarschullehrer zu uns.
Hier, in der Schule, lernen die Kinder, dass Hochdeutsch etwas Schwieriges und Fremdes ist. Sie lernen, dass Hochdeutsch den Deutschen gehört, dass die Schweizer es von den Deutschen nur zum Schreiben ausleihen und es sowieso nie so gut beherrschen werden wie die. Sie lernen, dass es unschweizerisch ist, so Deutsch zu sprechen wie die Leute im Fernsehen. Es dauert nicht lange, bis die kleinen Schweizer jede Freude an der deutschen Sprache verloren und diese ungesunde Mischung aus Verachtung und Bewunderung erlernt haben, die man als Schweizer einem geschliffen sprechenden Deutschen gegenüber zu empfinden hat.
Wenn es nicht positiv vorgelebt wird durch Lehrer und Medien, dass es schick und cool sein kann, sich auf Hochdeutsch zu verständigen, und dass das praktische Beherrschen dieser zweiten Muttersprache nicht nur für das Schreiben nützlich ist sondern auch relativ einfach lernbar, dann wird Deutsch von den Kindern eben bald als „schwierig“ empfunden und verachtet.
Wir können immer schlechter Hochdeutsch, und schlimmer noch, es scheint uns nicht zu kümmern. Viele Schweizer sind seltsam stolz auf ihre sprachliches Unvermögen, ist es doch der Beweis dafür, dass wir sind, wer wir sind, vor allem aber, dass wir anders sind als die. Es scheint zwar seltsam, sich über etwas zu definieren, das man nicht kann, aber etwas Besseres bleibt uns offenbar nicht: Das unbeholfene Deutsch macht uns Schweizer erst zu Schweizern.
Auch die Schwaben sind stolz auf ihre sprachliches Unvermögen. Sie machen Werbung mit dem Satz „Wir können alles – ausser Hochdeutsch“ und würden dennoch nicht auf die Idee kommen, in einem Vorstellungsgespräch für eine Lehrstelle in Stuttgart etwas anderes zu sprechen als geschliffenes Hochdeutsch, so weit möglich, um die gute Schulbildung damit unter Beweis zu stellen.
Das Problem ist aber nicht der Dialekt an sich. Die Sprachforschung hat gezeigt, dass es Kindern Vorteile beim sprachlichen Ausdruck verschaffen kann, wenn sie mit Dialekt und Hochsprache zugleich aufwachsen. Die Schweizer sind mit ihrem Dialekt auch nicht der Sonderfall, der sie so gerne wären. Hunderttausende von Kindern wachsen in Deutschland mit Dialekten auf, sprechen zu Hause erst Badisch, Hessisch, Kölsch oder Platt und müssen Hochdeutsch genauso in der Schule lernen wie die Schweizer. Aber während in Deutschland der Dialekt ein schlechtes Image hat und als Sprache der Ungebildeten gilt, ist es in der Schweiz genau umgekehrt: Der Dialekt wird verherrlicht, Hochdeutsch abgelehnt. Hier liegt das Problem. (…)
Wer in Hochdeutsch ungeübt ist, dem fällt es selbstverständlich schwer, sich darin präzise auszudrücken. Weil wir also kein Hochdeutsch können, ist es eine Fremdsprache, und weil es eine Fremdsprache ist, müssen wir es auch nicht besser beherrschen.
Was dabei untergeht, ist jegliches Vermögen, sich in einer Schriftsprache auszudrücken. Abgesehen von der immer grösseren Geschwindigkeit, die Schweizer Jugendliche dabei entwickeln, wenn sie im Dialekt SMS schreiben oder emailen. Wir haben in vier Jahren Primarschulzeit in Bülach vermisst, dass auch nur ein einziges Mal ein zusammenhängender Text im Deutschunterricht geschrieben werden musste: Kein Aufsatz „Mein schönstes Ferienerlebnis“, keine spannende Nacherzählung, keine Entfaltung der freien Fabulierlust, all das wurde von den Kindern nicht gefordert. Höchstens mal ein Lückentext mit einer Einsetzübung.
Kaufmännisches Rechnen wurde ausgiebig geübt, schliesschlich wollen alle ins KV. Die Fähigkeit, sich schriftlich auszudrücken in dieser „Fremdsprache Deutsch“, ist kein Thema. Zum Glück gibt es ja die Schweizer Blogger, die uns täglich davon überzeugen, dass es noch Schweizer gibt, die Spass daran haben, sich in der Schriftsprache gekonnt zu äussern. Obwohl auch hier die Dialekt-Blogger-Welle rollt.
Mathieu von Rohr kommt zum Schluss:
Unser Verhältnis zum Hochdeutschen ist weniger ein Fall für die Pädagogen als einer für den Psychiater. Gegen die Vorbehalte, die inneren Blockaden, die deutschfeindlichen Reflexe, die zu dieser Deutschschweizer Sprachneurose geführt haben, kommt frühes Hochdeutsch in Schule und Kindergarten nicht an. Und doch ist es natürlich ein richtiger Schritt – vorausgesetzt, der Gebrauch des Hochdeutschen wird mit aller Konsequenz durchgesetzt. Trotz unwilliger Schüler, Lehrern und Eltern. Ist dieser Kraftakt geschafft, können vielleicht wenigstens unsere Kinder lernen, Hochdeutsch, die Sprache Frisch und Dürrenmatts, als das Eigene zu akzeptieren und nicht länger als das Fremde zu verteufeln. Vielleicht gar: Hochdeutsch zu lieben. Die Schweiz würde dran nicht zu Grunde gehen. Schon eher aus dem gegenteiligen Grund. Man kann nicht auf Dauer mit einer Sprache leben, die man verachtet.
Das konsequente Durchsetzen des Hochdeutschen, daran hat es uns immer gefehlt in den Bülacher Primarschulen. Dort wurde auf Dialekt gesungen, wurden die Leitmotive für das Handeln der Lehrer auf Dialekt im Treppenflur an die Wand gehängt, wurde mit den Kindern auf Dialekt Theater gespielt. Alles verpasste Gelegenheiten, spielerisch und vorbildhaft Standarddeutsch zu üben und zu gebrauchen. Leider Fehlanzeige.
Der Artikel von Mathieu von Rohr löste übrigens eine Flut von Leserbriefen aus, zustimmend wie ablehnend. Bis hin zu einer im Dialekt geschriebenen Aufforderung an den Autoren, doch für immer das Land zu verlassen.
Aufruf an die Schweizer: Sprecht Hochdeutsch!
Wir sind überzeugt davon, dass die Schweizer besser Hochdeutsch und Schriftdeutsch und Standarddeutsch sprechen und schreiben, als sie selbst glauben. Wir haben viele Schweizer kennengelernt, die es uns gekonnt vormachten, ohne mit der Wimper zu zucken. Schaut euch doch die vielen lesenswerten Schweizer Blogs an!
Diejenigen, die erst nur Schweizerdeutsch mit uns sprachen, trauten sich nach ein bisschen Ermutigung gleichfalls, ihr Hochdeutsch zu praktizieren. Es ist doch alles nur eine Sache des Selbstvertrauen und der Übung. Lasst Euch doch nicht einreden, dass ihr es nicht könnt! Die Deutschen sind doch auch nicht alle perfekt in Sachen Grammatik und Rechtschreibung.
Nehmt jede Gelegenheit war und sprecht Hochdeutsch mit Deutschen! Schlagt deren Aufforderung „Sie können ruhig Schwiizerdütsch sprechen“ einfach in den Wind und sprecht weiter Hochdeutsch mit Ihnen! Deutsch ist auch Eure Sprache, eure zweite Sprache. Ihr habt sie nicht von den Deutschen ausgeliehen nur zum Schreiben, ihr teilt sie Euch doch mit Ihnen. Und warum sollen die Deutschen diese wunderbare Sprache einfach so für sich alleine besitzen? Pflegt Eure Zweisprachigkeit wo ihr könnt und lasst Euch nicht hollandisieren!