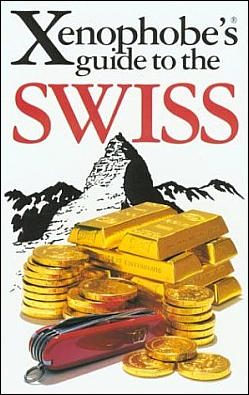Hinterüggsli gegen die grosse Wumme — Ein Text von Tom Zürcher
September 23rd, 2008Der Werbetexter Tom Zürcher schreibt unter dem Titel „Man textet deutsch“ eine wunderbare Analyse über das komplizierte Deutsch-Schweizer Verhältnis, besonders in der Werbebranche. Der Beitrag erschien in der Spezialausgabe des „Werbespalters“ (in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Satiremagazin „Der Nebelspalter“) und verdient unsere besondere Aufmerksamkeit. Der vollständige Beitrag ist hier online zu finden:
Hinterüggsli gegen die grosse Wumme (von Tom Zürcher)
Ich bin Schweizer und heisse auch so, fast. Ich bin gerne Schweizer, es ist ein schönes Land. Man darf nur nicht zu laut sein, weil, es ist ein kleines Land und wenn da jeder laut wäre, würden wir alle einen Ohrenschaden kriegen. Ich bin nicht laut. Meine Freunde sind auch nicht laut. Meine Nachbarn sind nicht laut, die Kinder meiner Nachbarn sind nicht laut, niemand ist laut.
Ausser die neuen Texter in der Agentur, die sind furchtbar laut. Weil, sie kommen aus einem grossen Land im Norden und dort muss man laut sein, um gehört zu werden. Oder sie sind laut, weil sie einen Ohrenschaden haben. Irgendeinen Schaden müssen sie haben, denn: Sie sagen, was sie denken. Das ist nicht normal. Das geht nicht. Wo kämen wir da hin, wenn jeder sagen würde, was er denkt? Das gäbe Streit, fürchterlichen Streit, und da man nicht leise streiten kann, sondern nur laut, hätten wir in der Schweiz bald alle einen Ohrenschaden. Drum sagen wir Schweizer nicht, was wir denken. Drum gibt es keinen Streit. Drum ist es ein schönes Land.
(Quelle: Für dieses und alle weiteren Zitate werbespalter.jimdo.com)
Prägnant und nachvollziehbar auf den Punkt gebracht! Nicht sagen, was man denkt, nicht laut sein. Streit vermeiden. Und schon ist es ein schönes Land. Wunderbar.
Als der erste neue Texter aus dem grossen Land zu uns kam, kam er gleich im Rudel. Wir Schweizer Texter konnten bei dem Krach nicht mehr texten. Wir dachten: Was ist unser CD für ein Fudiloch, dass er solche Schtürmicheiben einstellt! Wir sind dann hin zu ihm und haben gesagt: Chef, die sind prima, die Neuen, die bringen einen prima Schwung in den Laden. Leider sind sie ein bisschen äh laut, und … unser CD zuckte zusammen. Laut? Das geht nicht. Wo kämen wir da hin. Er beschloss, die neuen Texter müssten fortan im Keller texten, wo sie niemanden stören können ausser die in der Cafeteria, aber dort sitzen eh nur die neuen Texter, weil die Schweizer Texter arbeiten und sitzen nicht in der Cafeteria herum. Leider sind die Neuen nicht einverstanden gewesen mit dem Keller-Plan, sie haben protestiert, laut protestiert, so dass nun wir Schweizer Texter im Keller hocken. Aber es geht nicht schlecht. Wenn nur die in der Cafeteria sich etwas zurückhalten würden. Wir müssen es ihnen noch sagen.
Nun, jeder der in der Schweiz arbeitet, wird die Wichtigkeit der „sNüni-Pause“ und des gemeinsam getrunkenen Kaffees mitten in einer langen Verhandlung kennen. Man sitzt nicht lange rum, in der Cafeteria, aber keine Verhandlung beginnt ohne vorher einen Kaffee zu trinken oder wird fortgeführt ohne zwischendurch das Stehcafé aufzusuchen. Ist auch eine Form von Arbeit.
Die neuen Texter aus dem grossen Land reden nicht nur lauter, sie schreiben auch lauter – massiv lauter. Ihre Schlagzeilen erschlagen einen, und ihre Copytexte sind wahres Copygebrüll. Das wurde allerdings erst nach Ablauf der Probezeit ruchbar, denn vorher waren sie zu sehr damit beschäftigt, sich in der Cafeteria einzuleben. Den ersten Text, den wir von ihnen bewundern durften, hatten sie gleich zu dritt erarbeitet: eine Schlagzeile für ein Käseplakat. Selbstbewusst präsentierten sie sie der ganzen Agentur, trommelten alle im Plenarsaal zusammen und zeigten ihr Werk.
Es waren nur drei Worte. Eigentlich optimal für ein Plakat. Die Zeile hiess: Voll die Wumme!
Bleibt zu fragen, ob jeder Schweizer eine bildliche Vorstellung von diesem Gegenstand hat. Was ist eine Wumme? Die „Wümme“ ist ein Flüsschen bei Bremen, aber eine Wumme? Google hilft, und liefert prompt dieses hübsche Bild

(Quelle Foto: waltavista.de)
Auf einer Baustelle gilt das Wort „Wumme“ auch als Synonym für einen grossen Vorschlaghammer. Eine „Wumme“ ist also auch ein „Hammer“, mit dem man voll rein schlagen kann.
Wir waren alle erschlagen, einschliesslich der CD, dem wir ansahen, was er dachte: Was hab ich da bloss für Texter geholt. Sagen tat er: Bravo! und Wummie!, er klatschte in die Hände, und wir andern klatschten ebenfalls. Die ganze Agentur klatschte, alle ausser diejenigen neuen Texter, die nicht an der grossen Wumme beteiligt waren. Die pfiffen und schrieen Buu!, Buu! Auch so etwas, das wir von ihnen lernen konnten: Sich bei internen Präsentationen gegenseitig fertig zu machen. Keine Idee ist gut, ausser sie kommt von einem selber. Das geflügelte Wort bei solchen Anlässen heisst: Gabs schon! Noch bevor man die Pappe umgedreht hat, röhrt und gurgelt es: Gabs schon. Das blockiert natürlich den Ideenfluss ungemein. Was kann ich dafür, dass jede grosse Idee vom grossen Land schon gehabt worden ist? Unser CD versuchte dann, den Neuen ihre Gabsschon-Rufe auszutreiben. Indem er zu ihnen sprach: Er fände es gut, dass sie mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg zurückhalten, und ob wir nicht eine Zettelbox einführen wollen, um diesen befruchtenden Meinungsaustausch auf schriftlicher Basis zu standardisieren. Gabs schon!, brüllten sie, denn die Zettelbox war im grossen Land bereits 1980 in der Kreation von Schall & Frenetisch eingeführt worden.
Zurück zum Käseplakat: Das war noch nicht gegessen. Denn als der Agenturchef am nächsten Tag die Wumme sah, konnten wir hören, wie er dachte: Das gibts doch nicht. Er stand da und nagte an seiner Unterlippe. Die Neuen wollten wissen, was er denke, aber er schwieg beharrlich, so dass sie sich an die Beraterin wandten: Gefällt ihm unser Knack etwa nich? Die Beraterin, eine erfahrene Werberin, warb für Verständnis: Wie sollen wir das denn der Käserei verkaufen? Ihr Käse ist noch nicht reif für so einen lauten Auftritt. Das ist ein kleines Dorf, kleiner und leiser noch als die Schweiz. Da mach dich mal nich in Hemp. Det verkoofemer den Daddlduus gleich selpst!
Eine interessante Verschriftung von Berliner Dialekt. Lautete nicht die Grundregel „Schreibe als Deutsche niemals etwas auf Schweizerdeutsch ohne einen Schweizer zuvor um Rat zu fragen!“. Tom Zürcher hat da beim Berlinerisch weniger Hemmungen.
Gesagt, getan. Die neue Delegation reiste in die Berge und kehrte lachend zurück, denn sie hätten den Melkern und Sennen nicht nur das Plakat aufgeschwatzt, sondern auch gleich noch einen passenden Radiospot dazu, einen lauten Jodlerrap mit noch lauterem Refrain: Det wummt, det wummt, det wummt wummt wummt!
Der geneigte Schweizer Leser ahnt, was jetzt kommt: Die Wumme kam nicht. Die Käser riefen, kaum waren die Neuen aus dem Schatten ihrer Berge verschwunden, den Agenturchef an und bestellten eine neue Kampagne. So konnten die Neuen auch mal etwas von uns lernen, nämlich die Bedeutung des lustigen Wortes hinderüggsli. Mag sein, dass sie diesen Schweizer Wesenszug als böse und gemein empfinden. Aber das ist es nicht. Hinderüggsli ist nichts anderes als die Überlebensstrategie eines kleinen, leisen Landes im Kampf gegen die grosse, laute Invasion.
Ist das eine echte Schweizer Verteidigungsmethode? Hinderügglsi zu agieren? Tom Zürcher meint ja:
Wir Schweizer sind Naturtalente im Hinderüggsli. Das ist genetisch bedingt. Unser Nationalheld hat den Gessler von hinten erschossen, also hinterrücks. Ich bin auch gut im Hinderüggsli. In den Gängen der Agentur schwärme ich von Günther Netzer und Karlheinz Rummenigge, und im stillen Kämmerchen bzw. Kellerchen schreibe ich diesen Artikel. Was solls. Es können nicht alle laut und bis ins Steissbein von sich überzeugt sein, es braucht auch ein paar Schweizer auf der Welt.
„Hinterügglsi“, für die Leser aus Deutschland muss ich da noch erklären, ist „Hinterrücks“ oder „Hinter dem Rücken“. Das Schweizer Gegenteil der Deutschen „Direktheit“. Wie der Autor schon sagt: Hinter dem Rücken für Deutschen Fussball schwärmen, oder beim Zettelschreiben in der Waschküche seinen Namen vergessen. Oder bei der geplanten Wiederwahl eines Bundesrats einfach einen „Sprengkandidaten“ aus dem Hut zaubern. Hinterügglsi in Perfektion.