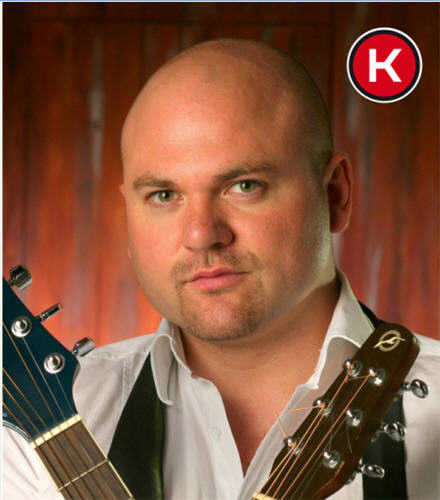Es besammeln sich die Genossamen
Dezember 12th, 2008(reload vom 27.2.06)
Wir kannten bisher die „Genossen“, mit ihren Genossenschaften. Wir amüsierten uns schon früh über die Verfechter der totalen Kleinschreibung, wenn sie den Satz schrieben: wir haben in moskau liebe genossen.
Nun lernten wir eine neue Spezies von Genossen in der Schweiz kennen: „Die Genossamen“. Im Kanton Schwyz gibt es heute noch 70 davon .
In unseren Ohren klingt das Wort wie eine Kreuzung aus „Genesis“ und „Samenspende“, wobei wir natürlich nicht die gleichnamige Rockgruppe meinen, sondern das erste Buch Mose.
Oder kommt „Genossamen“ von „Genossen und -sinnen, Tach z’saamen!“, etwas schneller ausgesprochen? Das wäre der Niederrheinische Deutungsversuch, doch der ist sicher falsch. In der Schweiz wird nicht „gespeist“, sondern „gespiesen“, vielleicht wird dann bei Schnupfen nicht „geniest“, sondern „genossen“? In einer Genossam?
Jedenfalls muss auch unser armer Duden „für einmal“ passen, er kennt die Genossamen nicht. Aber Google-Schweiz weiss Bescheid, und zwar an 721 Orten.
Wir stiessen bei der Lektüre des Tages-Anzeiger auf die Erklärung für dieses Wort.
Tages-Anzeiger vom 11.02.06 S. 2:
Die Tradition der Schwyzer Genossamen geht zurück ins 5. Jahrhundert. Sie ist also bedeutend älter als die Eidgenossenschaft. Damals besiedelten alemannische Bauern das Gebiet des heutigen Kantons Schwyz. Sie gründeten die Korporation Oberallmeind, um jenes Land zu verwalten, das nicht einem einzigen Bauern gehörte sondern der Allgemeinheit. Zu diesem gemeinsamen Land gehörten vor allem Alpen, aber auch Weiden und Wald. Wer Anteil an der Allmeind haben wollte, musste Landmann sein und aus freiem, altem Schwyzer Geschlecht stammen. Im Jahr 1882 stimmten die Bürger einer Teilung der Korporation zu. So entstanden die heutigen Dorfgenossamen.
Also wirklich nichts Neues. Warum schaffen die es dann plötzlich auf die zweite Seite des Tages-Anzeigers? Nun, weil etwas Sensationelles passiert ist. Dieses Bürgerrecht konnte im Kanton Schwyz nur von seinen Vorfahren erben, wer einen alteingesessenen Namen trug wie Feusi, Hiestand, Jäger oder Türkyilmaz.
Wenn ein bestehendes weibliches Mitglied einen Mann mit einem fremden Namen heiratete, war es aus und vorbei mit der Clubmitgliedschaft für die Kinder. Kein eingesessener Name, keine Genossamen-Mitgliedschaft:
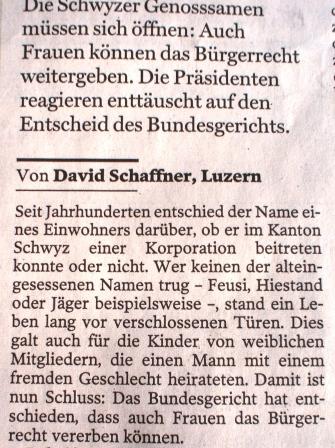
Das ist ein herber Rückschlag für die Korporation Pfäffikon, deren Präsident Ueli Feusi im Tages-Anzeiger zitiert wird:
„Schon zum zweiten Mal ändert ein Gericht von oben herab unsere Tradition“. Vor dreizehn Jahren habe man hinnehmen müssen, dass auch die Frauen einer Korporation beitreten können. „Nun hat das Bundesgericht entschieden, dass auch der Name nichts mehr zählt“.
Die „Steuerrevue“ sieht in den Genossamen „Privilegierte Gesellschaften“:
Steuerbefreiung von Genossamen
Schwyzer Genossamen und Korporationen unterscheiden sich wesentlich von den Walliser Burgergemeinden, welche gemäss Bundesgerichtsurteil von der direkten Bundessteuer befreit sind. (…) Es wird eine erhebliche wirtschaftliche Betätigung ausgeübt. Diese dient den eigennützigen Interessen ihrer Mitglieder und nicht gemeinnützigen oder öffentlichen Zwecken. Schwyzer Genossamen und Korporationen schütten ihre Gewinne in der Regel in Form eines Genossennutzens aus und erbringen genossen- schaftliche Leistungen an ihre Mitglieder, was den Anforderungen des Bundesgerichts zuwiderläuft. Eine Steuerbefreiung ist sachlich nicht gerechtfertigt, (…)
(Quelle: Steuerrevue.ch)
Hören wir da nicht irgendwie so etwas wie Neid heraus? Hinein durfte nur, wer den richtigen Namen trug, und bis vor 13 Jahren mussten neben dem X-Chromsomen auch noch ein anständiges Y-Chromosom vorhanden sein. Doch das ist leider vorbei. Wie meint Präsident Feusi noch so schön laut Tages-Anzeiger:
„Es lohne sich nicht, allzu viele Tränen zu vergiessen. Der Zeitgeist habe sich geändert“
Wir werden jetzt gleich die kleinste Geige der Welt auspacken und ein wirklich trauriges Lied spielen, um eine Träne zu vergiessen. Vielleicht kommt ja der Zeitgeist kurz vorbei und übernimmt die zweite Stimme? Wir fänden es schön.