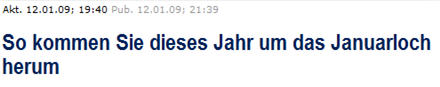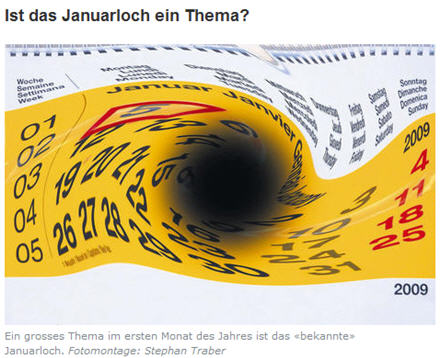Wenn Kinder gross und satt werden wollen wie Grossätti — Neue alte Verwandtschaftsnamen in der Schweiz
Februar 25th, 2009(reload vom 29.3.06)
Wir lasen im Fachblatt für das angewandte Leben in der Schweiz, der „Schweizer Illustrierten“ Nr. 9 vom 27.02.06 auf S. 62:
Die Familie lebt! Und zwar altbewährt und topmodern. Für die Kinder immer noch wichtig: das Grosi und der Grosätti. Gemanagt wird die Familie nach wie vor von der Frau: Mutter ist die Beste, sie ist der Boss. Die Kinder haben alles, Handy, Compi und Klamotten – und sind damit doch ganz zufrieden.
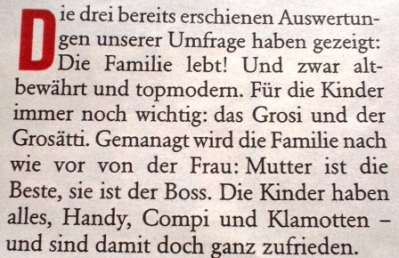
Offensichtlich wieder eine Verwandtschaftsbezeichnung, die uns in den letzten fünf Jahren in der Schweiz einfach unterschlagen wurde. Hatten wir im Süddeutschen Raum schon häufig von „Göttis“ (vgl. Blogwiese ) sprechen hören, so mussten wir uns bei den Grosseltern immer mit„Oma und Opa“ begnügen.
In der Schweiz sagt man zur Oma „Grosi“ oder „Grossmami“, natürlich sächlich, wie „das Mami“. Unser Variantenwörterbuch des Deutschen kennt sie alle, diese Bezeichnungen für die Verwandtschaft, und es weiss sogar, dass man die Oma in Liechtenstein „Nana“ nennt. Das kommt uns allerdings merkwürdig vor, denn im Französischen Sprachraum ist „Nana“ seit dem berühmten gleichnamigen Roman von Emile ZOLA ein Synonym für „Mädchen, Mädel, Tussi“, wie konnte das bei den Liechtensteinern nur zu einer Grossmutter mutiere? Vielleicht analog zum Begriff für Grossvater der dort „Neni“ genannt wird? Das „riecht“ nach italienischem Einfluss, denn dort heissen die Grosseltern „nonno“ und „nonna“.
Auf was haben wir uns da eingelassen. Wie kamen wir bisher in der Standardsprache nur mit dem simplen „Opa“ oder „Opi“ aus, der sich so wunderbar für Reime eignete?
Schade auch, dass heute kaum noch jemand Ingo Insterburg & Co. kennt, die hatten nämlich schon in den siebziger Jahren mit einem Reim vor den Folgen des Drogenmissbrauchs gewarnt:
Gibst Du dem Opi Opium, bringt Opium den Opi um.
(Quelle rheine.de)
„Ähne“ dürften selbst viele Schweizer nicht kennen, denn das kommt aus Vorarlberg und wird dort neben „Ahnl“ oder „Ehnel“ in Todesanzeigen verwendet. Ganz nebenbei lernen wird, dass die Bezeichnung „Vorarlberg“ immer ohne Artikel auskommt, also niemals aus „dem“ Vorarlberg schrieben wird.
Doch am besten gefällt uns der „Grossätti“, denn der klingt für Kinderohren nach „ziemlich gross“ und „satt“. Google-Schweiz findet für Grossätti 597 Einträge:
148 Belege immerhin noch für die Version mit einem S wie Grosätti. In Google Deutschland finden wir gerade mal 27 Belege, zumeist sind das Liedtitel von Dialekt-CDs:
Thun: Dr Grossätti uf em Tanzbode;
(Quelle: musik-outletters.de)
Das ist hier ein Lied aus der Stadt „Thun“, gelegen am Thunersee, die bekannt ist für den von dort kommenden delikaten Fisch, und es geht hier nicht um einen promovierten Mediziner namens „Grossätti“ sondern um einen tanzenden Opa. Alles klar? Weil die Thuner es nicht leiden können, mit dem Fisch verwechselt zu werden, haben sie in der Eidgenossenschaft durchgesetzt, dass man diese leckere Speise „Thon“ nennt, mit einem „o“ wie in „Ton-Figur“ oder „Ton-Leiter“.
Hier noch ein paar Beispiele für die Verwendung von „Grossätti“ in der Schweiz:
«Grossätti besass ein Handörgeli. Abends spielte er oft zum Tanz auf». Seine Eltern emigrierten in jungen Jahren ins Welschland und seine Wiege stand auch in Le Bouveret am Genfersee. Weil dort das Leben recht karg war, kehrte die Familie zurück nach Wengen und Grossätti erlernte den Zimmermanns-Beruf.
(Quelle: jungfrau-zeitung.ch)
Oder hier auf einer Homepage über die freiwirtschaftliche Bewegung im Baselbiet der Dreissigerjahre:
„I wäiss scho, hüttigtags wäi die Junge au afe läbe, wie die in de Stett, im Aesse wie in de Chläidere, niem isch meh z’friede, und das isch euser Eländ; […] Vo Sigaretli und halbfränkige Sigare het me au no nütt gwüsst, der Grossätti hätt se äim usim Muul gschlage; aber jetz set afe der Grossätti dene Grossgrinde folge und se förchte. So witt si mer cho mit de neue Schuele und ohni Religion.“
(Quelle: baselland.ch)
Was „Grossgrinde“ hier bedeutet, konnten wir nicht herausfinden. Vermutlich „Grosskinde“ = Enkelkind.
Unser Duden hingegen schweigt zu Grossätti. Auch das sonst so ergiebige Online-Wörterbuch von Leo kennt diese Bezeichnung nicht.
Die Konkurrenz von Duden, der grosse „Wahrig“ kennt es ebenfalls nicht, aber schlägt dafür einfach „Grossaktionär“ vor. Na klar, hat ja mindestens sieben gemeinsame Buchstaben wie „Grossätti“.
Und dabei liesse sich mit all diesen Bezeichnungen so wunderbare Kalauer schreiben, die mir Neni einfallen würden, weil ich Ähni auf diese Wörter gekommen wäre. Aber wahrscheinlich sehen Kinder das irgendwie anders, weil sie klein sind.