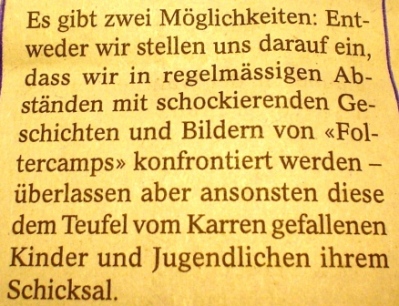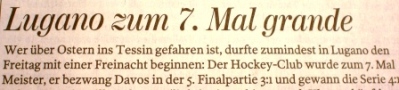Friedrich Hegel in Zürich? — Der Ursprung des Zürihegel-Laufs
Mai 20th, 2009(reload vom 24.5.06)
In Zürich findet dieser Tage ein besonderes Ereignis statt. Es trägt den hübschen Namen „Zürihegel“ und hat, wie Sie jetzt richtig vermuten, mit dem schwäbischen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel wenig zu tun.
Das Event findet jedes Jahr im Mai-Juni statt und heisst offiziell „De schnällscht Zürihegel“. Für die armen deutschen Leser, die jetzt nichts mehr schnallen: Es handelt sich hier um einen Wettlauf für Kinder, den es bereits seit 1951 gibt. „Schnällscht“ = schnellste.

Das erzählt uns die Website zuerihegel.ch:
1950 war kein Zürcher im Sprinterfinal der Schweizermeisterschaft. Das war für das LCZ Clubmitglied Silvio Nido, Rekordhalter im Hammerwerfen, ein Alarmzeichen. Er untersuchte die Sache, besuchte Spielplätze, Turnstunden, sprach mit den Fachleuten. Das Ergebnis war deutlich; das Laufen spielte in der Notengebung im Turnen eine absolut untergeordnete Rolle. Weder der Schnellauf noch die Ausdauer wurde in der Schule gepflegt oder gar gefördert. Silvio Nido schlug im Winter 1950 an der Seniorenversammlung des LCZ vor, eine Kommission zu bilden, die sich mit der Organisation eines Laufwettbewerbes für Schüler befassen sollte. Da die Sache aber finanziellen Einsatz benötigte, kam die Angelegenheit vor die Generalversammlung. Mit grossem Mehr wurde der Vorschlag angenommen.
(Quelle: zuerihegel.ch)
Nur mühsam könnten wir von befragten Schweizern erfahren, warum dieser Lauf denn so heisst. Gibt es vielleicht einen „Hügel“ in Zürich, der „Hegel“ genannt wird, über den der Lauf geht? Viele Nicht-Zürcher müssen bei dem Wort passen, denn es ist eine lokale Besonderheit.
Ein Zürihegel ist ein Kind aus Zürich. Wie genau diese Definition nun aufzufassen ist, konnten wir nicht feststellen. Für die Herkunft des Wortes gibt es verschiedene Auslegungen. Am plausibelsten erscheint uns Grimms Wörterbuch:
narr, querkopf, schweiz. hegel, baurenhegel grobian STALDER 2, 30; im Aargau wird der eigenname Heinrich in den spottnamen Heichel, Zürih-Hegel ‚querkopf‘ umgesetzt. ROCHHOLZ bei FROMM. 6, 458b; es rührt das mundartliche verbum hegeln, ‚hernehmen, mit worten oder schlägen, auf eine niedrige art foppen‘ (STALDER a. a. o.), bair. hegeln zum besten haben, aufziehen, necken (SCHM. 2, 164), schwäb. hegen plagen (SCHMID 268) an; als die den hegel gefoppet (officiere einen neuen ehemann), er würde mir (der frau) die hosen lassen müssen. Simpl. 3, 40 Kurz.
(Quelle: Grimm)
Hier ist also der „Zürih-Hegel“ als Querkopf bereits genannt. Ob die in dieser Gegend früher wirklich alle „Heinrich“ = Heichel = Hegel hiessen?
Der Duden leitet den Namen auf einen Hag = Gebüsch zurück:
Hegel:
1) Wohnstättenname zu mhd. hegel, Verkleinerungsform von mhd. hac Dornbusch, Gebüsch; Einfriedung, Hag oder von mhd. hege Zaun, Hecke .
2) Auf eine Koseform von Hagen (3.) zurückgehender Familienname.
3) Für Nürnberg kann eine Ableitung von mhd. hegel, hegelīn Spruchsprecher, Gelegenheitsdichter infrage kommen. In den Nürnberger Polizeiordnungen (13.-15. Jh.) ist von den pfeiffern, hegeln und pusaunern, die zu dem tantz hofieren [musizieren], die Rede.
(Quelle: duden.de)
Das wollen wir uns gleich mal merken für die nächste Diskussion mit Zürchern oder wahlweise Nürnbergern: „Hör auf mich so zu hegeln!„. Oder: „noch ein Wort und ich werde Dich hegeln…“ Ob dann wirklich jemand versteht, was gemeint ist? „Den Hegel foppen“ ist hoffentlich nicht weit verbreitet im Schwäbischen, so wie es Grimms Wörterbuch angibt.
Vielleicht gab es ja in Zürich besonders viele Dornenbüsche, Gebüsche oder Einfriedungen. Den „Hag“ kennt man in der Schweiz nur unter dem Namen „Zaun“, weil die Migros vor vielen Jahren ihre Eigenmarke mit koffeinfreiem Kaffee so nannte: Kaffee Zaun.

(Quelle Foto: swissbymail.com)
Denn Hag = Zaun, wie wir gerade im Duden lesen konnten. Dass da zufällig ein grosser Deutscher Markenhersteller namens „Hag“ auch ein entkoffeiniertes Kaffeeprodukt auf dem Markt hat, dass konnte doch vom Migros-Marketing niemand wissen!
Doch zurück zum „Zürihegel“. Wir kennen solche lokalen Spezialnamen auch aus anderen Städten, dort wird gleich auch eine Definition mitgeliefert.
In Freiburg im Breigau heissen die Kinder „Friburger Bobbele“:
Als „Friburger Bobbele“ bezeichnet man jemanden, der In Freiburg im Breisgau geboren ist und dessen Eltern und Großeltern ebenfalls aus Freiburg stammen. Dann sollte man noch im St. Elisabethen-Krankenhaus in Freiburg zur Welt gekommen sein und mindestens einmal in ein Freiburger „Bächle“ gefallen sein. Die Anforderungen an ein echtes „Friburger Bobbele“ sind also hoch.
Woher kommt der Begriff „Friburger Bobbele“?
Wenn man den Zeittafeln der Freiburger Adressbücher aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg Glauben schenken darf, findet man den für alle „Bobbele“ bedeutenden Eintrag „Eröffnung einer Normalschule unter Franz Josef Bob, 1773“. Alle seine Schüler nannte man ab sofort Bobbele und heutzutage nennt man alle typischen Freiburger so.
(Quelle: akverlag.de)
Der Name hat also nichts mit den „Bobbel“ = Bollen zu tun, den hübschen roten Kugeln auf den Trachtenhüten im Schwarzwald:

(Quelle lahr.de)
Bobbele ist in Deutschland natürlich noch ein Spitznamen für Boris Becker.
Wussten Sie übrigens, dass nach seinen Wimbledon Siegen 1985 und 1986 die Zahl der Kinder, die in Deutschland den Jungennamen „Boris“ bekamen, schlagartig zurück ging?
Sportlicher Erfolg eines Namensträgers heisst noch lange nicht, dass der Name auch populär wird! „Kevins“ gab es zur gleichen Zeit dafür umso mehr, wegen Kevin Keegan und Kevin Costner, der da gerade „mit dem Rolf“ tanzt, oder sich „einen Wolf“ tanzt, und später „Kevin allein zuhause“.