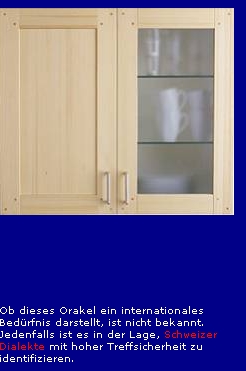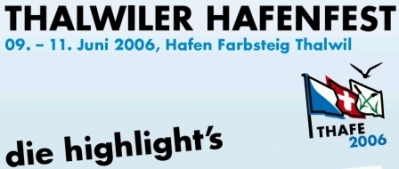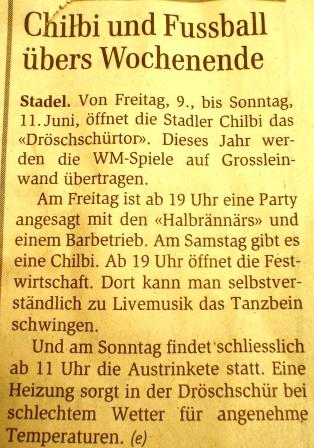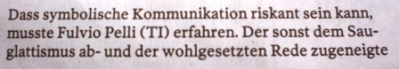Katrin Bauerfeind entdeckt die Schweiz von A bis Z
November 30th, 2009Wer die Ex-Ehrensenf Moderatorin und heutige Harald Schmidt Kollegin Katrin Bauerfeind in aufklärender Mission in der Schweiz erleben will, sollte heute (Montag, 30.11.09) um 20:15 Uhr 3SAT einschalten, oder sich den Film in voller Länge im Internet ansehen hier. Von A wie Alpen bis Z wit Zither kann man hier auch jeden Buchstaben-Beitrag einzeln angucken. Richtig freundlich und lehrreich ist R wie Regeln, „Hallo ist zu nah!„. OK, dann halt „Hoi„. „Den, den wir sehen, dem sagen wir Grüezi“. In Deutschland hauen wir uns in einer solchen Situation lieber gleich eins in die Fresse. „Effizientes Kommunizieren“ heisst das im Beitrag. Obwohl, die Grussformel „Hoi“ wurde gar nicht erwähnt im Kommentar von Katrin Bauerfeind. „Man sagt Tschüss-Zsamme„…, na ja. Unter Deutschen vielleicht.

(Quelle Foto: 3sat.de)
Auf der Webseite von 3SAT heisst es dazu:
Mit unseren Nachbarn ist das so eine Sache: Die Franzosen bewundern wir für ihr „savoir vivre“. Die Dänen finden wir nett, aber das tun eigentlich alle. Die Polen: Das ist eine wechselvolle Beziehung. Und mit den Niederländern verbindet die Deutschen eine heißkalte Liebe. Doch was ist mit den Schweizern?
Oft nehmen wir in typischer „Germanen“-Manier und gebildet durch zahllose Urlaubsreisen an, alles – zumindest alles Wichtige – über die Eidgenossen zu wissen. Doch was macht ein Schweizer, wenn er seinen „Puff“ aufräumt? Oder wer weiß schon, dass in der Schweiz teilweise bis 1950 Waisen- und Scheidungskinder auf Märkten versteigert wurden? Wir müssen eingestehen: Unser Wissen endet oft irgendwo zwischen Tell und Toblerone!
Beim Buchstaben „S“ wie „Schweizerdeutsch“ versucht sie sich beim Erlernen der Schweizerischen Possessivpronomen, und beisst sich dran die Zähne aus.
In der gleichen Reihe erschien auch „Deutschland von A bis Z“ und „Österreich von A bis Z„. Der Sender 3SAT tut was für die Völkerverständigung. Warum sie dann nicht endlich diese merkwürdigen Untertitel für „10 vor 10“ und andere Schweizer Sendungen abschaffen, verstehen wir dennoch nicht.