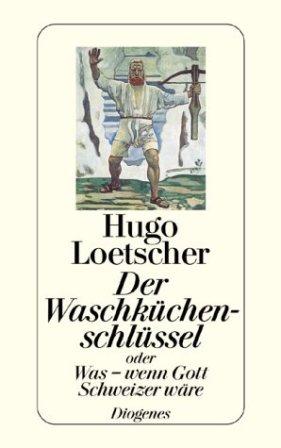Die aus dem „grossen Kanton“
Wir haben auf der Blogwiese viel über die versteckten und von den Deutschen zum Grossteil nicht wahrgenommenen Aversionen mancher Schweizer gegenüber den zugezogenen Einwohnern aus dem nördlichen Nachbarland berichtet. Schon die Umschreibung „die aus dem grossen Kanton“ zeigt uns eine Dichotomie auf, welche die uns bekannten Schweizer in zwei Gruppen teil. Wir nennen sie die „Integrierer“ und die „Abgrenzer“. Wer von Deutschland als vom „grossen Kanton“ spricht, ist ganz offensichtlich ein Integrierer, denn hier wurde ganz Deutschland bereits zum Teil der Schweiz erklärt, natürlich nur im Spass, oder sollten wir ein Referendum „Beitritt Deutschland als 27. Kanton der Eidgenossenschaft“ ins Leben rufen? Warum nicht gleich alle Länder der EU? „Confoederatio Europae“ oder CE, mit Sitz in Bern, wo sonst, wäre doch kein schlechtes Staatenmodell für die Zukunft, oder?
Aber es gibt noch mehr als nur diese beiden Grundtypen. Darum heute eine kleine Typologie der deutschfreundlichen Schweizer und wie Sie sie erkennen können.
Fragen Sie: „Soll ich Schweizerdeutsch lernen?“
Diese einfache Frage müssen Sie Ihren Schweizer Nachbarn, Kollegen, Freunden oder Bekannten stellen, um sie schnell und einfach in unsere kleine „Typologie der deutschfreundlichen Schweizer“ einordnen zu können:
Der Abgrenzer
„Ach nee, lass das lieber. Das tönt sowieso ganz furchtbar, wenn ein Deutscher versucht Schweizerdeutsch zu lernen. Bleib Du bei Deinem Heimatdialekt.“ Und im stillen denkt er sich noch: „… und lass uns den unsrigen, denn den geben wir nicht her, den wollen wir nicht teilen. Wenn wir den nicht hätten, wie sollten wir uns dann noch von Euch unterscheiden?“
Abgrenzen, unterschieden, eine klare Trennlinie ziehen, dass ist die Vorgehensweise des „Abgrenzers“. Die Angst vor der Ähnlichkeit mit dem anderen, vor dem Verlust der eigenen Identität, die vielleicht nur auf die Sprache begründet ist, das mag hier die tiefenpsychologische Grundlage für die Denkweise des Ausgrenzers sein.
Der Integrierer
„Na klar, lerne so schnell wie möglich Schweizerdeutsch! Aber geh erst in die Öffentlichkeit damit, wenn Du es perfekt kannst..“ Dann wirst Du so wie wir, einer von uns, kaum mehr zu unterscheiden.
Der Integrierer hat erkannt, dass die Schweiz sowieso eine permanente Durchmischung und Vermischung von Dialekten erlebt, wie es im Begriff „Bahnhofbüffet-Olten-Dialekt“ zum Ausdruck kommt. Vielleicht hat er selbst schon mehrfach den Kanton gewechselt in jungen Jahren und stets wieder von vorn begonnen mit dem Dialektlernen. Das prägt fürs Leben.
Der Ungeduldige
„Wie, Sie sind schon zwei Jahre hier und haben immer noch nicht den Schweizerpass beantragt? Wann lernen Sie endlich Dütsch sprechen so wie alle hier?“ . Auch solchen Menschen kann man in der Schweiz begegnen. In der Regel sind diese Menschen entweder nie aus der Schweiz herausgekommen, oder sie kamen selbst als Secondos hierher, und sind nun glühende Verteidiger der neuen Heimat. Alle Nachzügler müssen es ihnen gleich tun.
Der Ungläubige
„Die Deutschen sind sowieso nicht in der Lage, überhaupt irgendeine Fremdsprache zu lernen. Manche der jüngeren können Englisch, aber auf Mallorca bestellen Sie ihren Kaffee Haag mit Eisbein und Sauerkraut immer noch ausschliesslich auf Deutsch.“
Der Ungläubige kennt die Deutschen gut, denn er gucke ja immer deutsches Fernsehen, da weiss man bald alles über das Land und die Menschen. Vor allem über das Schulsystem und die erste und zweite Fremdsprache dort. Die Filme sind seiner Meinung nach in Deutschland immer in der Originalfassung zu sehen, weil niemand dort Englisch oder Französisch kann.
Der Tolerante
„Ach, du kannst reden wie Du willst. Soll ich auch Hochdeutsch reden oder kommst Du klar, wenn ich Schweizerdeutsch spreche?“. Der Tolerante hat unter Garantie selbst Jahre im Ausland verlebt, vielleicht seine Ehefrau von dort mitgebracht, und spricht 3-4 Sprachen fliessend.
Der Germanophile (aus der Westschweiz)
„Oh, sprich doch bitte weiterhin Hochdeutsch mit mir! Es klingt so schön. Endlich kann ich reden, wie ich es jahrelang in der Schule gelernt habe. Hier in Zürich sprechen alle sofort Französisch mit mir, wenn ich nur den hochdeutschen Mund aufmache, dabei will ich doch mein Deutsch nicht verlernen. Ich werde wohl doch so einen Kurs bei der Migros-Klubschule besuchen müssen, wenn ich noch länger hier leben und arbeiten möchte.“
Und was meint der Wissenschaftler dazu?
Werner Koller ist Zürcher, Sprachwissenschaftler und hat die sprachsoziologische Untersuchung «Deutsche in der Deutschschweiz» veröffentlicht.

(Quelle Foto: hf.uib.no)
In einem Interview mit dem Bund wurde er zu der Situation der Deutschen in der Schweiz befragt:
«bund»: Manche Deutschen, die schon lange in der Schweiz leben, fühlen sich immer noch nicht heimisch – wie kommt das?
Werner Koller: Deutsche haben beste Voraussetzungen für das «Heimisch-Werden» in der Schweiz: Sie unterscheiden sich weder vom Aussehen noch vom kulturellen Hintergrund stark von den Schweizern. Paradox ist: Gerade wegen der Ähnlichkeiten werden die Unterschiede umso stärkerer wahrgenommen. Es gibt viele Deutsche, die die ersten Jahre als problematisch, ja belastend empfinden. Sie erleben die Situation in der Schweiz verschiedener, als sie es erwartet haben. Das betrifft Mentalität und Charakter, die Art und Weise, wie Schweizer miteinander umgehen, und vor allem die Stärke der Vorurteile, die sie gegenüber Deutschen haben. Die Unterschiede müssen nicht gross sein, damit man in der Schweiz als Ausländer behandelt wird.
(Quelle: Der Bund vom 17.06.06, auch alle weiteren Zitate dort)
Streng nach der alten Devise: Jeder ist fast überall auf der Welt ein Ausländer. Wir erinnern noch einmal an die Bekannten aus Ostdeutschland, die hier in der Schweiz alles sehr schön fanden, „bis auf die schrecklich vielen Ausländer“. Kein Witz, bittere Realität ohne Selbsterkenntnis.
Auf die Frage, ob die Deutschen Schweizerdeutsch lernen sollen, meint Werner Koller:
Natürlich kann man Schweizerdeutsch, wie jede andere Sprache, lernen. Es gibt viele in der Schweiz wohnhafte Deutsche, die Schweizerdeutsch sehr gut sprechen. Bei einigen denken Schweizer höchstens, dass sie «aus einem anderen Kanton» stammen. Das Problem liegt nicht beim Können, sondern bei der Motivation: Man kann sich in der Deutschschweiz mit Hochdeutsch verständigen.
Richtig. Ein Deutscher muss hierfür einsehen, was es bedeutet, in der Schweiz den nicht einfachen Lokaldialekt tatsächlich lernen zu wollen. Die wochenlangen Reportagen einer Deutschen bei Blick haben die Leser nicht nur amüsiert, sondern auch aufgezeigt, wie schwierig es ist, nicht verschriftete Sprachen systematisch zu lehren und zu lernen.

(Quelle Foto: Blick.ch 02.10.06)
Sprache ist mehr als ein Kommunikationsmittel. Werner Koller meint:
Sprache markiert Identität, meine Sprache und ich – wir gehören zusammen. Zur sozialen Identität gehört auch die Zugehörigkeit zu einer Region, einem Dorf – und die Sprache verrät, «woher man kommt». Wenn Deutsche, die hauptsächlich Hochdeutsch sprechen, die Grussformeln Grüezi, Uf Widerluege verwenden, signalisieren sie die Bereitschaft, an den sprachlichen Ritualen teilzunehmen, sich den Gewohnheiten der Schweizer anzupassen.
Warum kann beim Versuch, Deutsch zu lernen, auch das Gegenteil bei den Schweizern auslösen?
(bund): Deutsche, die Schweizerdeutsch sprechen, kommen nicht gut an . . .
(W. Koller) Das kann man so allgemein nicht sagen. Tatsächlich werden Deutsche mit zwei Haltungen konfrontiert. Einerseits geben Schweizer zu erkennen, dass sie durchaus sprachliche Anpassung erwarten. Andererseits hören Deutsche auch, sie sollten «bei ihrer Sprache bleiben». Die Abwehrreflexe kommen in Aussagen zum Ausdruck wie: Deutsche sollen ihre Identität bewahren und sich nicht «ins Schweizerische drängen». Deutsche sollen nicht Dialekt reden, weil der Dialekt der Abgrenzung gegenüber «dem grossen Bruder im Norden» dient.
Da wären wir bei unserem Lieblingstypen, dem Abgrenzer. Es ist nicht leicht zu wissen, wie man mit all diesen verschieden Typen umgehen sollte, es gibt auch kein Patentrezept, denn nicht jedem fällt das Sprachenlernen leicht. Ich persönlich habe beschlossen, als nächstes mindestens zwei rätoromanische Sprachen zu lernen, um so mitzuhelfen, diese Varianten vor dem Aussterben zu bewahren. Mal sehen wie weit ich dann in Zürich komme, wenn auf Rumantsch nach dem Weg frage.

![]()