Komm lass Dich aufrichten — Wenn Schweizer Bauarbeiter feiern
Februar 14th, 2006Geht es Ihnen auch so schlecht in dieser düsteren Jahreszeit? Alles drückt auf das Gemüt, Sie sind ewig müde und abgespannt? Womit könnte Ihnen geholfen werden? Vielleicht durch einen original Schweizer „Aufsteller“ oder einer Schar „aufgestellter Leute“ (vlg. Blogwiese).
Wir lasen im Tages-Anzeiger vom 28.01.06 (S. 17) von einer Schweizer Veranstaltung, die kann Sie vielleicht wieder aufrichten:
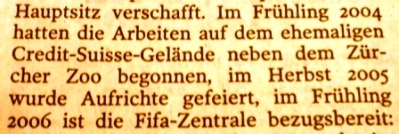
Wird da ganz aufrichtig ein moralisch niedergeschlagener Mensch aufgerichtet? Vielleicht jemand, der mit seiner „An-richte“ nicht mehr zufrieden war? So ganz richtig ist das nicht, was wir da anrichten. Denn auch in Deutschland wird bei dieser Veranstaltung alles richtig gemacht, es heisst darum auch „Richt(ig)fest„. In unserem Tagi-Artikel ging es um die Baustelle des Fifa-Neubaus beim Zürcher Zoo (der sehr weit weg von der Zoll-Grenze liegt und darum nicht „Zolli“ heisst wie der in Basel):
Wir finden das hübsche Wort sogar im Duden erklärt:
Auf|rich|te, die; -, -n (schweiz.):
Richtfest:
„Ein bräunliches Foto aus Fees Album zeigt den stolzen Hausgründer am Tag der Aufrichte.“ (Muschg, Gegenzauber 25).
Mit „Muschg“ ist hier übrigens nicht das „Mutterschutz-Gesetz“ gemeint, das schreibt sich „MuSchG“ in Deutschland, sondern der Schweizer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Adolf Muschg, dem wir eine grossartige Biographie Gottfried Kellers verdanken. „Gegenzauber“ ist kein Schweizer Harry-Potter-Verschnitt, sondern sein zweiter Roman von 1967.
Google-Schweiz findet die Schweizer Form für das deutsche „Richtfest“ übrigens 11.700 Mal erwähnt, Google-Deutschland nur 828 Mal, wobei diese Fundstellen mit allem Möglichen zu tun haben, was aufgerichtet wird, aber nicht mit Hausbau.
Feiern die hier ein Richtfest oder eine Aufrichte?

(Quelle Foto haldemann-holzbau.ch)
Die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm kannten in ihrem 16 Bd. langem Deutschen Wörterbuch zwar „aufrichten“, „aufrichtig“ und „aufrecht“, nicht jedoch die „Aufrichte“. Also bleibt dieses Wort wie so viele andere auf ewig auf der „Insel der aufgestellten Leute“ als Aufsteller allein. Schade eigentlich. Denn „Richtfest“, wer denkt da nicht eher an einen Scharfrichter mit Guillotine als an freudiges Häuslebauen?

