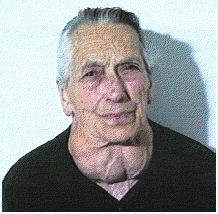Die Magie der höflichen Indirektheit — Nicole M. über die Kunst der Schweizerischen Kommunikation
Mai 24th, 2007Die Schweizerin Nicole M. beschreibt im Tages-Anzeiger, wie es ist, in der Schweiz mit einem Kopftuch unterwegs zu sein. Sie kam auf diese „Under-Cover-Kopftuch“ Aktion durch ein Erlebnis, dass ihr widerfuhr, als sie einen kurdischen Freund bei der Semester-Einschreibung an die Uni begleitet:
Wir werden vorgelassen, mein Freund bringt sein Anliegen vor. In einem nicht ganz korrekten, aber mühelos verständlichen Satz. Die Dame am Schalter schüttelt nur den Kopf. Mit einer Bestimmtheit, die ich ihr gar nicht zugetraut hätte, sagt sie: «Nein, das geht nicht, auf keinen Fall, da kann man gar nichts machen.» Mein Freund zuckt mit den Schultern und wendet sich ab, ist an solche diskussionslosen Absagen gewöhnt.
(Quelle: Dieses und alle weitere Zitate stammt aus dem Tages-Anzeiger vom 21.05.07, S. 20)
Hier lief offensichtlich etwas falsch in der Kommunikation zwischen dem Kurden und der Schweizer Dame am Schalter. Codizes wurden nicht eingehalten, Gesprächsregeln verletzt. Das beschreibt Nicole M. im Folgenden sehr präzise und mit exakter Beobachtungsgabe, denn für Schweizer sind diese Dinge nicht leicht wahrzunehmen, weil sie so selbstverständlich sind im Alltag:

(Quelle Foto: Tages-Anzeiger vom 21.05.07 Foto von Thomas Burla)
Nun wende ich mich der Dame zu und wiederhole, was mein Freund gesagt hat. Wiederhole nur, sage den gleichen Satz wie er, sage ihn aber auf Schweizerdeutsch und makellos, geschminkt mit ein paar Höflichkeitsfloskeln, in gutschweizerischer Indirektheit. Man sagt «Könnte ich vielleicht» (mit Betonung auf vielleicht, obwohl man gar nicht vielleicht meint, sondern unbedingt), man sagt «Meinen Sie, es wäre möglich» (obwohl einen die Meinung des anderen nicht im Geringsten interessiert), statt «Kann ich» oder «Können Sie bitte» (wobei es egal ist, ob das bitte fehlt, denn bereits die Verwendung des Indikativs an Stelle des Konjunktivs gilt als unhöflich). Dazu macht man, gutschweizerisch, ein verlegen verkniffenes Gesicht, zeigt die Zähne als Zeichen der Zerknirschung, atmet zischend ein und wiegt voller Zweifel und Scham den Kopf hin und her. Ansonsten aber: das gleiche Anliegen, der gleiche Satz.
Jeder Sprachwissenschaftler hätte seine Freude an dieser Beschreibung, wenn die Situation nicht alles andere als lustig wäre:
Und plötzlich hellt sich das Gesicht der Dame auf, sie sagt «Aha!», als ob sie erst jetzt verstanden hätte, worum es geht, sagt «Ach so!» und winkt meinen Freund zurück, und plötzlich klappt alles reibungslos, plötzlich ist alles gar kein Problem mehr, eine kleine Formalität. Ich merke: Es gibt Signale, die eine bestimmte Haltung hervorrufen, einen bestimmten Umgangston. Es gibt Schlussfolgerungen: X spricht kein korrektes Deutsch, ergo ist er mir intellektuell unterlegen, denn ich spreche korrektes Deutsch (zumindest Schweizerdeutsch). X ist mir unterlegen, ergo stellt er dreiste Forderungen und versucht, mich zu überlisten und den Schweizer Staat (dessen Repräsentantin ich bin) zu untergraben, denn er muss seine Unterlegenheit irgendwie ausgleichen.
Ich bewundere Nicole für ihre Coolness und Perfektion, mit der sie in dieser Situation „Kreide gefressen“ hat, um das Ziel für ihren kurdischen Freund erfolgreich zu erreichen. Die richtigen Regeln der Kommunikation zu beherrschen ist auf jeden Fall ein grosser Pluspunkt im Leben, nicht nur in der Schweiz. Dies als kleiner Tip an alle Schweizer, die schon „Ich krieg noch ein Bier“ brüllen üben, wenn sie noch nicht ganz über die Deutsche Grenze gefahren sind.
Ergo (merke ich): Es gibt Signale, die die Schlussfähigkeit beeinträchtigen. Denn es heisst (fälschlicherweise) nicht: X spricht kein korrektes Deutsch, ergo sollte ich ihn nicht voreilig als unhöflich und dreist betrachten, denn er ist wahrscheinlich mit unseren sprachlichen Regeln der höflichen Indirektheit nicht vertraut und formuliert sein Anliegen deshalb (für mein Schweizer Ohr) zu direkt. Es heisst nicht: X spricht zwar nicht korrekt, aber doch ziemlich verständlich Deutsch, ergo ist er mir intellektuell möglicherweise sogar überlegen, denn ich spreche weder korrekt noch verständlich Türkisch, Serbisch, Kroatisch, Arabisch.
Besonders peinlich wird es, wenn jemand anfängt, lauter zu sprechen, weil er glaubt, damit besser verstanden zu werden. Mal darf jetzt bloss nicht glauben, dass nur die Schweizer diese Art der Kommunikation pflegen. In den wenigsten Ländern der Welt wird man schnell ans Ziel kommen, wenn man dreist und direkt heraus artikuliert, was Sache ist und was man gern hätte, auch nicht in Deutschland.
Machtmenschen und verstockte Angestellte, die umschmeichelt werden möchten, gibt es sicher auch anderswo. Versteckter oder offen zur Schau getragener Rassimus und Überheblichkeit ebenfalls. Mir passiert es in solchen Situationen oft, dass ich, anstatt das Höflichkeitsspiel mitzuspielen, trocken sarkastisch reagiere, was der Sache nicht immer ganz zuträglich sein mag. Ein Satz wie „Oh, ich wollte eigentlich nur gern ein bisschen Geld ausgeben, kann mir jemand helfen?“ in einem Geschäft, in dem offensichtlich kein Interesse am Kunden besteht, wirkt nicht immer produktiv. In einem Schweizer Hotel sollte ich neulich meinen Wohnort in den Meldeschein eintragen und war drauf und dran in Versuchung „Ausbildungslager Al-Qaida, Pakistan“ hinzuschreiben, nur um zu sehen, ob das überhaupt jemand liest. Aber man sollte als Gast im Land lieber brav und höflich alle Riten mitspielen, um nicht anzuecken.