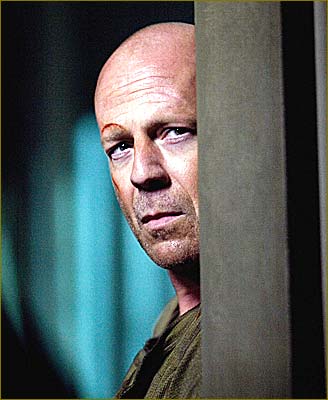Eine Fotze ist eine Gosche ist eine Schnorre ist ein Latz ist ein Sabbel
Auch nach sechs Jahren in der Schweiz geraten wir noch in Erstaunen über besonders hübsche und drastische Wortfunde, die im Schweizer Sprachalltag zwar selten aber doch lässig und unbedarft Verwendung finden. Die Rede ist von den Varianten rund um das derbe Wörtchen „Fotze“. Im Gemeindeutschen ist dies ein vulgäres Wort für das innere weibliche Geschlechtsorgan, laut Variantenwörterbuch im Süden in dieser Bedeutung jedoch seltener, mehr noch, es gilt in Österreich und Süddeutschland als Variante für „Mund“, neben weiteren Ausdrücken wie:
Pappen A, Gosche A D-süd, Schnorre A-west CH, Latz CH, Klappe CH D-nord/mittel, Fresse D-nord/mittel, Sabbel D-nord/mittel, Schnauze D (ohne südost), Schnute D
(Quelle: Variantenwörterbuch S. 258)
Da fehlt nur noch die „Klappe“ in der Liste, bzw. der „Rand“. Beides kann man halten in Deutschland.
Eine Fotze kann auch weh tun
Ausser für zwei Körperöffnungen gilt das Wort in Österreich und Deutschland auch als Synonym für eine gemeindeutsche „Ohrfeige“. Dieser schmerzhafte Vorgang bringt es ebenfalls auf eine Vielzahl von Varianten, in der Schweiz z. B. als „Chlapf“:
Dachtel A D-südost, Watsche A D-südost, Chlapf CH, Backpfeife D-nord/mittelwest, Schelle D-nordost/südost
(Quelle: Variantenwörterbuch S. 258)
Und die Fotzelschnitte?
Sie ist tatsächlich essbar und hat mit den oben erwähnten Körperöffnungen ganz und gar nicht zu tun. Sie ist eng verwandt mit dem „Fötzel“, der sich sogar im Duden findet:
Fötzel, der; -s, – [wohl zu alemann. Fotz = Zotte, Fetzen, H. u.] (schweiz.): Lump, Taugenichts.
(Quelle Duden.de)
Besonders in der Kombination mit „fremd“ als „fremder Fötzel“ erfreut sich dieses Wort grosser Beliebtheit in der Schweiz, 214 Fundstellen bei Google-CH mögen als Beleg genügen:
So im Zürcher Unterländer:
«Fremde Fötzel» mussten weichen
(Quelle: zuonline.ch)
Oder im Velojournal.ch:
Geniale Scheidegg und fremde Fötzel
(Quelle: velojournal.ch)
Doch was hat der „Dahergelaufene; Fremde“ mit einer essbaren Schnitte gemein? Die „Fotzelschnitte“, so erfahren wir aus dem Variantenwörterbuch, ist ein
„Gericht aus in Milch eingeweichten, in Ei gewendeten, gezuckerten und in Butter gebratenen Brotstücken“.
(Quelle Variantenwörterbuch S. 258)

(Quelle Foto: luckymagenta.spaces.live.com)
Ein Gericht also, dass man in Österreich als „Pafese“ kennt und in Deutschland als „arme Ritter“, in der Schweiz auch als „verlorenes Brot“ oder „Goldschnitte“ serviert. Ein einfaches Gericht für arme Leute, diese „Fotzelschnitte“, nur nicht mit Rittern zubereitet sondern mit „Dahergelaufenen“, bzw. „Fremden“.
Ein Fötzel ist ein Fetzen Papier?
Ein „Fötzel“ an sich hat in der Schweiz zwei Bedeutungen. Zum einen ist es:
Fötzel, der; -s, – (mundartnah) — Lump, Taugenichts.
(Quelle: Schweizer Wörterbuch von Kurt Meyer S. 123)
Zum anderen ist es aber auch ein Fetzen Papier:
„Die Bürokratie verlangt für jede dritte Nacht die schriftliche Bestätigung eines Hotels. Reist man mit Fahrrad und Zelt, ist es nicht verwunderlich, dass die Papier unvollständig sind, also muss man sich die erforderlichen Fötzel mit etlichem Schmiergeld bei Hotels ergaunern
(Quelle: Velojournal 1/2002, 19; zitiert nach Variantenwörterbuch S. 258)
Man achte auf die Finesse, dass im „Velojournal“ vom „Fahrrad“ die Rede ist!
Aus diesem „Fetzen Papier“ leitet sich dann noch die beliebte Tätigkeit „fötzeln“ selbst ab, was nichts anderes bedeutet wie das Aufsammeln solcher Papierfetzen bzw. sonstiger Abfälle:
Asylbewerber «fötzeln» für ein Taschengeld
(Quelle: zuonline.ch)

Mir göi go „fötzeln“ in Kappeln
(Quelle: schulekappel.ch)
Besonders bemerkenswert finden wir an dieser Überschrift der Kappeler Schulzeitung, dass das Tätigkeitswort „fötzeln“ mit deutlichen Anführungszeichen als „nicht schriftfähig“ gekennzeichnet wurde. Richtig so! Wir sind uns eben schon deutlich bewusst, dass hier ausnahmsweise mal ein Dialektwort verschriftet wurde!
Frotzeln ist nicht fötzeln
Nicht verwechseln sollte man die umweltfreundliche und gemeinnützige Tätigkeit des „Fötzelns“ hingegen mit dem Gemeindeutschen „frotzeln“:
frọtzeln (sw). V.; hat› [H. u., viell. zu: Fratzen ‹Pl.›, Fratze] (ugs.): a) mit spöttischen od. anzüglichen Bemerkungen necken: jmdn. [wegen etw.] f.; b) spöttische od. anzügliche Bemerkungen machen: sie frotzelten gern über ihn.
(Quelle: duden.de)
oder mit dem derben Wort für „ohrfeigen“:
fotzen (sw) . V.; hat> [zu →Fotze] (bayr., österr. derb): ohrfeigen.
Fazit: Wir hören auf zu frotzeln, gehen am Wochenende im Wald fleissig fötzeln und laden alle fremden Fötzel ein zu einer Fotzelschnitte. Genial!