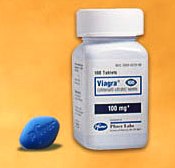„Goat’s euch guoat?“ — Erlebnisse in einem Schweizer Fitnessstudio
Oktober 11th, 2005Das Firmenschild steckt schon voller Rätsel. Es ist blau, wie Oxygenium=Sauerstoff, und orange, wie altes Eisen das oxydiert, also rostet? Soll ausdrücken: Wer rastet, der rostet?
Mein Fitnessstudio Oxygymn

liegt im Bülacher Industriegebiet-Süd . Schick und nobel, mit Blick auf die neue Migros. Da fährt man nun mit dem Auto hin am Abend, um dort 2 Stunden auf der Stelle stehend Velo zu fahren. Spinnen die? Nein, die machen „Spinning“ Und warum heisst das so? Na, weil bei den Dingern sich wie beim Spinnrad vorn nur ein einzelnes Schwungrad dreht. Damit das dann nicht zu schnell und leicht geht, wird es künstlich und freiwillig (!) gebremst.
Welch eine köstliche Energieverschwendung. Könnte man doch einen Dynamo anschliessen und mit den aufgestellten TV-Geräten koppeln, oder noch besser mit der Musikanlage: Keine Muskelkraft, keine Musik, wäre doch enorm motivierend.
Hier eine Spinning-Gruppe, kräftig am Spinnen (aber nicht im Oxygymn aufgenommen)

Kurz vor Weihnachten reichte es mir mit der Untrainiertheit und dem Übergewicht. Statt zum gemeinsamen Firmen-Besäufnis meldete ich mich schnell entschlossen zum Sport an.
Auf dem Anmeldeformular sollte ich das Ziel meiner freiwilligen körperlichen Aktivitäten angeben. Das war einfach, das wusste ich genau, also schrieb ich: „Stark und schön werden“.
Die Frage nach eventueller in der Vergangenheit aufgetretene Gebrechen und Beschwerden bereiteten mir dann schon mehr Kopfzerbrechen. Schwanger war ich damals zwar nicht, auch wenn es so aussah; also versuchte ich es mit einer Gegenfrage:
„Muss ich alle drei Herzinfarkte angeben, oder reichen die letzten beiden.“ Als die Trainerin ganz weiss um die Nase wurde, beruhigte ich sie mit dem Nachsatz: „Sicherlich egal, bei Epileptikern sind Herzinfarkte nicht weiter tragisch…“ (zur Beruhigung: natürlich stimmt weder das eine noch das andere, Lumbago erfahrene Hypochonder kriegen nicht so leicht einen Herzinfarkt).
Ich reihte mich als Tanzbär in die Gilde der buntbedressten Hupf-Dolls ein. Befehle wie „Great-Behind, Side-Step, Jambo-Step, V-Step (Wiii-Step), Marsh, Leg-Cuuurl“ gingen mir in Fleisch und Blut über. „Und Eisss, und zwei, und drüüü … und gumpe, und gumpe, hintershii und fürreshii, und schnuffe niit vergesse..“
Die wichtigen Körperteile sind „Buch“ (nicht zum Lesen, sondern zum Anspannen), „Rukke“ (den stets ohne Ruck bewegen), und das „Pfüadli“ (schwäbisch „Fiedle“).
Ich liebte es, den jungen Drill-Sergeants mit vollem Einsatz nachzueifern, und wenn die aufmunternde Frage „Goat’s Euch guoat?“ gebrüllt wurde, brüllte ich stets zurück: „SIR, NO, SIR„, denn natürlich litt ich wie die Sau. Da stand ein hageres kleines weibliches Persönchen vor Dir mit einer Langhantel, die bei Ihr locker 15 Kg auf die Waage brachte, während ich Schwierigkeiten hatte, 2 x 3 Kg im gleichen Tempo zu stemmen, zu heben und zu halten. Da sollte man nicht frustriert werden?
Ich lernte den Trizeps zu modulieren und den Bizeps zu dehnen. Die wichtigsten Vokabeln sind „höch“ (= hoch), „abba“ (=hinab, runter), und der Schweizer Lokativ von Mitte = „Mitti“.
Die Trainerinnen heissen übrigens durchweg so wie vor 25 Jahren die Jungmädchen-Parfüms: „Conny S“ und „Anna B“ (klingt wie Ana-bolika), „Erika A“ und „Conny D“. Nein, eine „Jeanine D“ oder eine „Bony M“ ist nicht dabei.