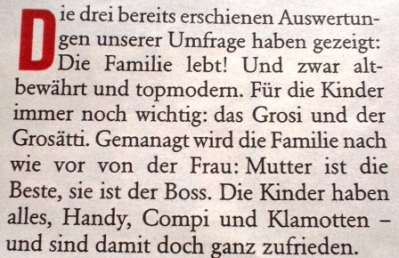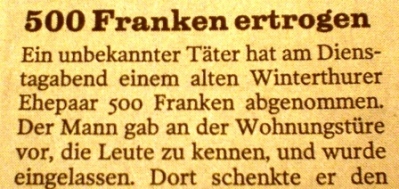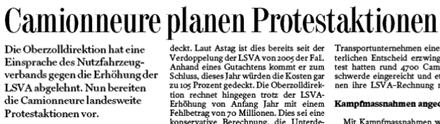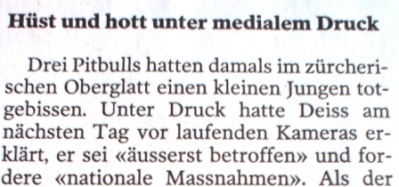Wer führt eigentlich hier den Mist? — Neue Schweizer Redewendungen
Februar 26th, 2009(reload vom 31.3.06)
Wir stolperten über einen Satz im Tages-Anzeiger vom 23.03.06 S. 15
Der Mist ist nun geführt, und das Urteil des Obergerichts ist rechtskräftig.
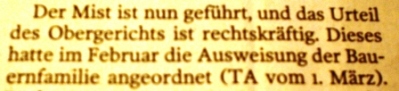
Es ging in dem Artikel um eine Bauernfamilie auf dem Döltschihof in Wiedikon, die nach einem Urteil des Obergerichts ihren Hof räumen muss. Der Satz passt also vollkommen in den Kontext, in dem es auch um biologischen Landbau und Milchkühe geht. Dennoch verstehen wir absolut nicht, warum man hier „Mist führen“ muss. Vielleicht ist es nur ein Schreibfehler, und es sollte heissen: „Der letzte Mist wurde aufs Feld gefahren“, die letzte Scheune leer geräumt, die Arbeit erledigt. Aber da steht eindeutig „geführt“, und nicht „gefahren“. Ob sie dort mit einem Ochsenfuhrwerk arbeiten, und die Zugtiere mit einem Karren voll Mist im Schlepptau auf das Feld „geführt“ werden müssen? Diesmal beschliessen wir, nicht viel Zeit mit Duden, Wahrig, Leo und Konsorten zu verlieren, sondern gleich das Variantenwörterbuch des Deutschen aus dem DeGruyter Verlag zu befragen. Und tatsächlich, wir lesen dort schwarz auf weiss auf Seite 505:
„Der Mist ist geführt“ CH ‚etw. ist gelaufen, erledigt’
Die Kräfte reichten nur bis zum ersten Gegentor. Dann war der Tank leer – und der Mist geführt (Blick 16.5.1998,15)
Suchen wir genau diesen Ausdruck „Der Mist ist geführt“ bei Google-Schweiz, so finden wir weitere schöne Beispiele:
Der Mist ist geführt Weltwoche, 17. August 2000
In Zürich und Chicago einst ein eigenartiger Hit, in New York jetzt ein peinlicher Flop: die kuriose Kuhparade.
(Quelle: hossli.com)
Oder auf der offiziellen Seite parlament.ch
Der Mist ist geführt
Weil die Finanzdelegation das dringliche Airline-Engagement gebilligt habe, stehe das Parlament vor einem „Fait accompli“, sagte Simon Epiney (CVP/VS).
(Quelle: parlament.ch)
Oder hier:
Die National- und Ständeratswahlen sind vorbei; die Resultate sind bekannt. „Der Mist ist geführt“, ist eine gängige Redensart dafür.
(Quelle: www.ref-ag.ch)
Verstehen Sie diese Redewendung?
Ganz ehrlich: Ohne den Hinweis des Variantenwörterbuchs wären wir nie auf die Bedeutung „etw. ist gelaufen, erledigt“ gekommen. Verstehen das die Schweizer einfach so auf Anhieb? Wo mag diese Redensart nur herkommen? Tatsächlich aus der Zeit, als in der Schweiz Zugtiere mit einem Karren voll Mist auf das Feld geführt wurden, und nach Ausbringen dieser Fuhre einfach „alles erledigt, alles gelaufen“ war.
Weil man nun auf dem Feld so lange nichts mehr arbeiten konnte, bis sich der Gestank verzogen hatte? Alles nur unsere Vermutungen. Ist diese Redewendung vielleicht im kollektiven Bewusstsein der Schweizer so fest verankert, weil hier alle irgendwie von Vorfahren abstimmen, die im Agrarsektor tätig waren? Nun, bekanntlich ist auch die „Grande Nation“ Frankreich früher ein Agrarland gewesen, dass erst sehr spät den Umbau zur Industrienation erlebte. Die meisten Franzosen haben Vorfahren aus irgendeinem kleinem Dorf der Province, die in Frankreich gleich hinter der Stadtautobahn von Paris, dem „Boulevard périphérique“ beginnt. Und im Ruhrgebiet weideten vor 150 Jahren noch Kühe, bis ein Kuhhirte in Bochum im Lagerfeuer plötzlich glühende Steine fand, womit die Kohle auch dort entdeckt und die Bauernidylle zu Ende war. Vielleicht ist es darum auch in der Schweiz an der Zeit, sich daran zu erinnern, dass in solchen Redewendung „bäuerliche Grunderfahrungen“ konserviert werden. Frei nach der alten Schweizer Bauernregel:
„Wenn der Bauer führt den Mist, dann ändert nicht die Sprache, sondern sie bleibt, wie sie ist“