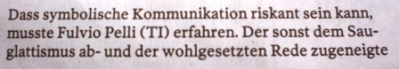Richtiges Ohrfeigen erlernen Sie spielerisch — Träntnen in der Schweiz
Juni 5th, 2006Die Schweizer sind hart im Nehmen. Wenn Sie nicht genau wissen, wo es lang geht, in welcher Richtung sie beim Spielen die Karten ausgeben müssen. So zum Beispiel beim Schwyzer Kartenspiel „Träntne“.
Damit kommen wir zu den Spielregeln des Träntne, wie es 1977 im Schwyzer Muotatal gespielt wird. Sie wurden vom Wirt Erasmus Betschart aufgestellt, vom Gemeindekassier Toni Büeler geordnet und ergänzt und von den sechs Rangersten am zweiten Prüsträntne korrigiert. Dieses Verfahren war notwendig, weil bis heute keine Regeln dieses komplizierten Spiels geschrieben sind. (…)
Gespielt wird meist zu viert in zwei Parteien zu zwei, zuweilen auch zu sechst in zwei Parteien zu drei Spielern. Als Karten dienen die zo Bildkarten des Schweizer Jass (früher nahm man auch noch die Neun dazu). Ausgegeben wird im Uhrzeigersinn, während schon in Schwyz wie in der übrigen Schweiz wider den Uhrzeigersinn (der Ohrfeige nach) gespielt wird.
(Quelle: erlebnis-illgau.ch)
Moment, haben wir diese Regel jetzt richtig verstanden? Wenn vergessen wurde, wie rum die Karten ausgegeben werden müssen, dann steht ein Spieler auf, gibt dem Mitspieler eine Ohrfeige (vorzugsweise mit der rechten Hand auf die linke Wange), dann ist wieder alles klar: So rum geht es weiter, einfach „der Ohrfeige nach“.
Brutale Sitten in der Innerschweiz. Die Uhrenindustrie im Jura muss einfach zu weit entfernt gelegen haben, dass man sich sowas Technisches wie „gegen den Uhrzeigersinn“ merken konnte. Das mit der Ohrfeige ging leichter. Richtung vergessen? Ohrfeige kassiert, Richtung wieder gewusst!
Hier ein besonders schönes Exemplar vom Duo Diagonal:

(Foto Paul Silberberg)
Auch in einer Regel für das Domino-Spiel entdecken wir diese Wendung:
Die Spielrichtung erfolgt in landesüblicher Weise (z. B. in Deutschland im Uhrzeigersinn, in der Schweiz jedoch entgegen dem Uhrzeigersinn, oder wie dortige erfahrene PädagogInnen erklären: in Richtung der Ohrfeige …).
(Quelle: dominospiel.de)
Die Standarddeutsche Ohrfeige bringt es im übrigen auf eine ganze Reihe von Varianten in den verschieden deutschsprachigen Ländern Europas. So kann man in Österreich und im Südosten von Deutschland dazu auch „die Dachtel“ sagen, oder man teilt eine „Watsche“ aus. Im Norden und in Mitteldeutschland pfeift hingegen lautmalerisch die „Backpfeife“, wenn es knallt. Der Schweiz „Chlapf“ (in Deutschland eher ein Knall, Schnall, Rumms oder Bumms) ist eigentlich eher ein lautmalerisches Synonym für den Schlag auf die Wange. Er findet sich nebst der Pluralform „die Chläpfe“ genau wie alle anderen hier zitierten Varianten im DeGruyter Variantenwörterbuch der Deutschen Sprache.
Das Chlapf, Knall, Schnall, Rumms und Bumms immer ein und dasselbe Geräusch umschreiben können, zeigt uns wieder, wie exakt die Wissenschaft der Onomatopoesie oder Lautmalerei doch sein kann.
Jetzt suchen wir noch tapfere Mitspieler zum Erlernen von „Träntnen“. Die kompletten Regeln finden sich hier . Ich spiele aber nur mit, wenn ich anfangen darf und nicht als zweiter rechts vom Spielmacher sitzen muss. Sie wissen schon warum. Wussten die Leute im Muotatal eigentlich, das das Spiel als „Trenta“ auch in Spanien gespielt wird? Was heisst eigentlich „der Ohrfeige nach“ auf Spanisch?